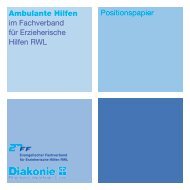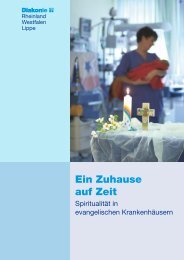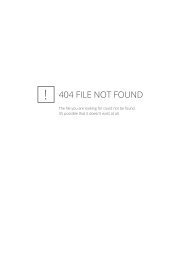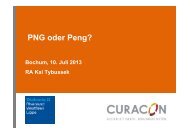Dokumentation - Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
Dokumentation - Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
Dokumentation - Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Nun finden wir weder<br />
im Grundgesetz noch<br />
an anderer Stelle in<br />
unserer Rechtsordnung<br />
eine Definition des<br />
Kindeswohls. “<br />
3 Siehe dazu die Stellungnahme<br />
des Bundesjugendkuratoriums<br />
vom Dezember<br />
2007, Jugendamt 2008, 72.<br />
14<br />
ihre Befugnis zum Wohle des Kindes ausüben,<br />
handeln sie im Rahmen ihrer Elternverantwortung<br />
und können sich auf den<br />
Grundrechtsschutz von Artikel 6 Abs. 2<br />
Satz 1 GG berufen; nur insofern lässt sich<br />
die Fremdbestimmung des Kindes durch<br />
seine Eltern vor Art. 2 Abs. 1 in Verbindung<br />
mit Art. 1 Abs. 1 GG (Persönlichkeitsrecht<br />
des Kindes) rechtfertigen. Die Entscheidungsfreiheit<br />
der Eltern endet – nach der<br />
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts<br />
– dort, wo sie für ein Handeln in<br />
Anspruch genommen wird, dass selbst bei<br />
weitester Anerkennung ihrer Selbstverantwortlichkeit<br />
nicht mehr als „Pflege oder Erziehung“<br />
gewertet werden kann.<br />
Nun finden wir weder im Grundgesetz noch<br />
an anderer Stelle in unserer Rechtsordnung<br />
eine Definition des Kindeswohls. In vielen<br />
fachlichen Publikationen werden Versuche<br />
unternommen, diesen Begriff zu definieren<br />
oder Mindeststandards zu formulieren.<br />
Dabei wird aber schnell deutlich, dass es<br />
kaum möglich ist, diesen umfassenden Begriff<br />
alters und entwicklungsspezifisch zu<br />
operationalisieren. Die rechtliche Bedeutung<br />
solcher Versuche bliebe zudem begrenzt.<br />
Da Eltern nach unserer Verfassung<br />
grundsätzlich frei von staatlichen Einflüssen<br />
und Eingriffen nach eigenen Vorstellungen<br />
entscheiden, wie sie die Erziehung ihres<br />
Kindes gestalten und damit ihrer Elternverantwortung<br />
gerecht werden wollen, kommt<br />
dem Staat auch nicht die Befugnis zu, das<br />
Kindeswohl zu definieren. Er hat vielmehr<br />
die Aufgabe der rechtlichen Grenzkontrolle,<br />
nähert sich damit dem Kindeswohl von seiner<br />
negativen Ausprägung her 3 .<br />
c) Das staatliche Wächteramt<br />
Welche Bedeutung hat nun das in Art. 6<br />
Abs. 2 Satz 2 GG formulierte staatliche<br />
Wächteramt? Der Sinn des Wächteramts<br />
liegt darin, das Wohl des Kindes vor Schaden<br />
zu bewahren, und zwar so weit wie<br />
möglich unter Wahrung und Schonung der<br />
verfassungsrechtlich verbürgten Elternbefugnisse.<br />
Es soll objektive Verletzungen<br />
des Wohls des Kindes verhüten – unabhängig<br />
von einem Verschulden der Eltern. Insofern<br />
kann das Wächteramt als Schranke<br />
des Elternrechts qualifiziert werden. Dies<br />
bedeutet: Das staatliche Wächteramt hat<br />
im Hinblick auf das Elternrecht nachrangi-<br />
gen Charakter. Der Staat hat die elterliche<br />
Erziehungsautonomie, soweit sie reicht, zu<br />
respektieren. Die Grenze für diese elterliche<br />
Erziehungsautonomie bildet die Kindeswohlgefährdung.<br />
Nach diesem Verfassungsverständnis muss<br />
die Gesellschaft unterschiedliche Lebensstile<br />
und Erziehungsvorstellungen von Familien<br />
akzeptieren. Der Staat kann zwar<br />
versuchen, Eltern von der Wünschbarkeit<br />
eines anderen Erziehungsverhaltens<br />
zu überzeugen; dies geschieht auch im<br />
Rahmen von Beratung und anderen Erziehungshilfen,<br />
aber er muss letztlich auch<br />
solche Erziehungsformen akzeptieren, die<br />
von einer pädagogisch wünschenswerten<br />
Förderung der Entwicklung von Kindern<br />
entfernt sind, solange diese nicht mit einer<br />
Gefährdung des Kindeswohls einhergehen.<br />
Was ein solches Verständnis von Elternprimat<br />
und staatlicher Befugnis zur Kontrolle<br />
der Grenzen elterlicher Erziehungsverantwortung<br />
konkret bedeutet, dies hat<br />
das Bundesverfassungsgericht vor mehreren<br />
Jahren am Beispiel minderbegabter Eltern<br />
anschaulich gemacht, die ihr Kind nicht<br />
ausreichend fördern (können). Dazu hat es<br />
ausgeführt: „Zwar stellt das Kindeswohl in<br />
der Beziehung zum Kind die oberste Richtschnur<br />
der elterlichen Pflege und Erziehung<br />
dar. Dies bedeutet aber nicht, dass es<br />
zur Ausübung des Wächteramts des Staates<br />
nach Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG gehörte,<br />
gegen den Willen der Eltern für eine bestmögliche<br />
Förderung des Kindes zu sorgen.“<br />
Das Gericht fährt fort: „Das Grundgesetz<br />
hat die Entscheidung über den weiteren Bildungsweg<br />
des Kindes nach Abschluss der<br />
Grundschule zunächst den Eltern als den<br />
natürlichen Sachwaltern für die Erziehung<br />
des Kindes belassen. Die primäre Entscheidungszuständigkeit<br />
der Eltern beruht auf<br />
der Erwägung, dass die Interessen des Kindes<br />
in aller Regel am besten von den Eltern<br />
wahrgenommen werden. Dabei wird die<br />
Möglichkeit in Kauf genommen, dass das<br />
Kind durch den Entschluss der Eltern wirkliche<br />
oder vermeintliche Nachteile erleidet,<br />
die im Rahmen einer nach objektiven Maßstäben<br />
betriebenen Begabtenauslese vielleicht<br />
vermieden werden könnten“.<br />
Diese Entscheidung stößt immer wieder auf<br />
Unverständnis, weil sie dem Kind eben nicht<br />
eine „bestmögliche Förderung seiner Ent-