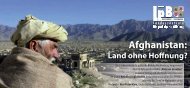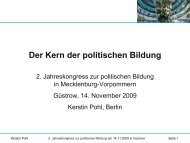Gedenkstättenführer - Landeszentrale für politische Bildung ...
Gedenkstättenführer - Landeszentrale für politische Bildung ...
Gedenkstättenführer - Landeszentrale für politische Bildung ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
dene Gedenkstätten, die ehemalige Lagerstandorte und Gefängnisse markieren.<br />
Für die unmittelbare Nachkriegszeit sind es vor allem ehemalige<br />
NKWD-Gefängnisse und das sowjetische Speziallager Fünfeichen bei Neubrandenburg.<br />
Mit der Gründung des Ministeriums <strong>für</strong> Staatssicherheit in<br />
der DDR 1950 übernahmen die Standorte der Staatssicherheit in Rostock,<br />
Schwerin und Neubrandenburg/ Neustrelitz mit ihren Gefängnissen eine<br />
zentrale Funktion bei der Verfolgung <strong>politische</strong>r Gegner. Weitere Orte wie<br />
das Gefängnis in Bützow, die Erinnerungsstätten <strong>für</strong> das DDR-Grenzregime<br />
sowie die Erinnerungszeichen <strong>für</strong> den Widerstand künden von der repressiven<br />
Seite der SED-Diktatur sowie ihrer Überwindung im Herbst 1989.<br />
Die baulichen Überlieferungen und die Gedenkstätten <strong>für</strong> die Opfer staatlicher<br />
Gewalt im 20. Jahrhundert gehören zur Kulturlandschaft von Mecklenburg-Vorpommern,<br />
zum öffentlichen Gedächtnis des Landes. Doch sie<br />
stehen – im unterschiedlichen Ausmaß – <strong>für</strong> eine unbequeme Geschichte,<br />
der wir uns bewusst stellen müssen, um die Folgen dieser Vergangenheit<br />
zu bewältigen, um reflektiert mit den dunklen Seiten unserer Vergangenheit<br />
umgehen zu können und den aktuellen Gefährdungen demo -<br />
kratischer Verhältnisse überzeugend entgegentreten zu können.<br />
Am Beginn des 21. Jahrhunderts verändern sich die Konturen des Erinnerns<br />
an die Geschichte des 20. Jahrhunderts. 4 Zum einen sind die Fortschritte<br />
in der historischen Forschung zur NS-Geschichte und der ostdeutschen<br />
Nachkriegsgeschichte unübersehbar, andererseits muss jede<br />
Generation unter den jeweiligen gegenwärtigen Bedingungen ihr eigenes<br />
Verhältnis zur Vergangenheit entwickeln, was ohne lebensgeschichtliche<br />
Bezüge zu den Ereignissen natürlich anders ausfällt als mit ihnen. Wie<br />
gehen wir mit den unterschiedlichen, sich teilweise widerstreitenden Erinnerungen<br />
um? Wie sprechen wir über die Vergangenheit, um den vielen<br />
Opfern gerecht zu werden, aber auch die Unterschiede zwischen den<br />
Verfolgungskomplexen nicht zu verwischen? Wie wird sich die Erinnerung<br />
mit dem Ende der Zeitgenossenschaft verändern? Der Übergang<br />
5<br />
Gedenkstein auf dem Jüdischen Friedhof<br />
in Anklam, 2004, Foto: Politische Memoriale e. V.<br />
4 Vgl. Knigge, Volkhard/Frei, Norbert (Hrg.),<br />
Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung<br />
mit Holocaust und Völkermord, München<br />
2002; Hüttmann, Jens/Mählert, Ulrich/Pasternack,<br />
Peer (Hrg.), DDR-Geschichte<br />
vermitteln. Ansätze und Erfahrungen in Unterricht,<br />
Hochschullehre und <strong>politische</strong>r <strong>Bildung</strong>,<br />
Berlin 2004; Zukunft der Erinnerung,<br />
Aus Politik und Zeitgeschichte 25-26/2010.