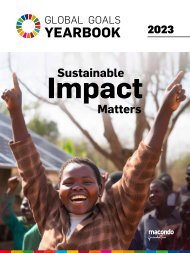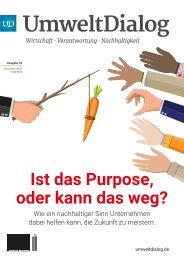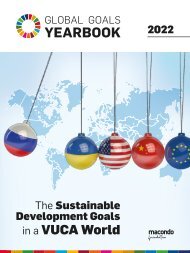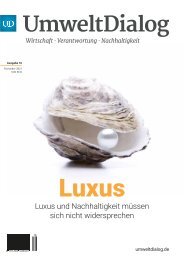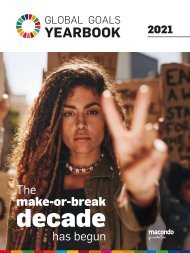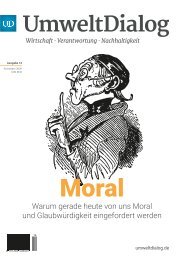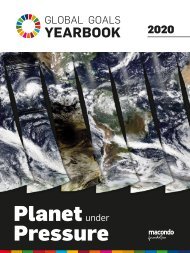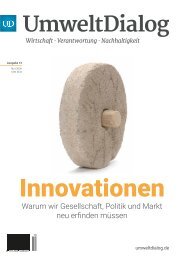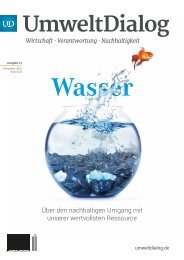Global Compact Deutschland 2020
Vor zwanzig Jahren wurde der Global Compact ins Leben gerufen. Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan forderte, dass Globalisierung für alle gelingen müsse. Mit Hilfe von zehn Prinzipien drängte der Compact auf weltweit gleiche Regeln. Die aktuelle Ausgabe des deutschen Global Compact Jahrbuchs zieht Bilanz, lässt wichtige Protagonisten zu Wort kommen und beleuchtet mit vielen Praxisbeispielen die ungebrochene Aktualität der UN-Initiative. Stimmen "Die Antwort auf die Globalisierung lautet also globale Verantwortung. Zusammenarbeit auf der Grundlage der globalen Nachhaltigkeitsziele entscheidet über unser aller Zukunft: Entsprechend zukunftsweisend erweist sich verantwortungsvolle Unternehmensführung im Sinne des Global Compact. Herzlichen Dank Ihnen allen, die sich dafür stark machen." Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin "Kofi Annan war 1998 Gastredner auf dem World Economic Forum, und er war nicht sehr angetan. Er hat dann ganz klar gesagt, ich gehe da nur noch hin, wenn ich etwas Wichtiges zu sagen haben. Der Job ist auf mich gefallen, etwas Entsprechendes für ihn vorzubereiten." Georg Kell, erster Exekutivdirektor des UN Global Compact (2000-2015) "In den letzten fünf Jahren seit der Einführung der Global Goals hat sich die Agenda für nachhaltiges Wirtschaften von einer sehr spezialisierten Agenda hin zu einem Top-Thema des Managements entwickelt." Lise Kingo, Exekutivdirektorin des UN Global Compact (2015-2020) "Wir müssen bei Nachhaltigkeitsthemen vorwärts kommen, und das sehen alle Seiten ein. Unsere Dialog-Formate können hier Brücken bauen, und das ist eigentlich das, was ich schon immer am DGCN gut finde." Angelika Pohlenz, Beiratsvorsitzende der Stiftung DGCN
Vor zwanzig Jahren wurde der Global Compact ins Leben gerufen. Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan forderte, dass Globalisierung für alle gelingen müsse. Mit Hilfe von zehn Prinzipien drängte der Compact auf weltweit gleiche Regeln. Die aktuelle Ausgabe des deutschen Global Compact Jahrbuchs zieht Bilanz, lässt wichtige Protagonisten zu Wort kommen und beleuchtet mit vielen Praxisbeispielen die ungebrochene Aktualität der UN-Initiative.
Stimmen
"Die Antwort auf die Globalisierung lautet also globale Verantwortung. Zusammenarbeit auf der Grundlage der globalen Nachhaltigkeitsziele entscheidet über unser aller Zukunft: Entsprechend zukunftsweisend erweist sich verantwortungsvolle Unternehmensführung im Sinne des Global Compact. Herzlichen Dank Ihnen allen, die sich dafür stark machen."
Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin
"Kofi Annan war 1998 Gastredner auf dem World Economic Forum, und er war nicht sehr angetan. Er hat dann ganz klar gesagt, ich gehe da nur
noch hin, wenn ich etwas Wichtiges zu sagen haben. Der Job ist auf mich gefallen, etwas Entsprechendes für ihn vorzubereiten."
Georg Kell, erster Exekutivdirektor des UN Global Compact (2000-2015)
"In den letzten fünf Jahren seit der Einführung der Global Goals hat sich die Agenda für nachhaltiges Wirtschaften von einer sehr spezialisierten Agenda hin zu einem Top-Thema des Managements entwickelt."
Lise Kingo, Exekutivdirektorin des UN Global Compact (2015-2020)
"Wir müssen bei Nachhaltigkeitsthemen vorwärts kommen, und das sehen alle Seiten ein. Unsere Dialog-Formate können hier Brücken bauen, und das ist eigentlich das, was ich schon immer am DGCN gut finde."
Angelika Pohlenz, Beiratsvorsitzende der Stiftung DGCN
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ihrer nichtfinanziellen Berichterstattung<br />
neigten viele Unternehmen dazu, eher<br />
über etwaige Risiken in der Lieferkette<br />
und deren Vorbeugung zu berichten als<br />
über aktuelle schädliche Auswirkungen<br />
der Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen<br />
und Lieferanten. Das hat<br />
eine 2019 ebenfalls von Development<br />
International erstellte und von iPoint<br />
geförderte Vergleichsstudie zur nichtfinanziellen<br />
Berichterstattung in<br />
<strong>Deutschland</strong>, Österreich und Schweden<br />
gezeigt. Dabei zeigten sich länderspezifische<br />
Unterschiede: Schwedische Unternehmen<br />
berichten nach Ansicht von Bayer<br />
und Ibañez besonders offen über den<br />
eigenen Impact auf menschenrechtliche,<br />
Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen<br />
in der Lieferkette.<br />
Als geeignetes Mittel gegen die uneinheitliche<br />
Befolgung der menschenrechtlichen<br />
und ökologischen Sorgfaltspflicht<br />
empfehlen die Autoren eine striktere<br />
Gesetzgebung nach französischem<br />
Vorbild. Unternehmen würden unter<br />
anderem auch deshalb dazu motiviert,<br />
ihren Due-Diligence-Verpflichtungen<br />
gewissenhaft nachzukommen, weil betroffene<br />
Akteure die Unternehmen sogar<br />
in Haftung nehmen könnten, falls sie<br />
ihnen Verstöße oder auch falsche oder<br />
nicht ausreichende Schutzmaßnahmen<br />
nachweisen können. Die Diskussion<br />
in der EU laufe auf ein solches Modell<br />
hinaus, das dann für Unternehmen aller<br />
Größen und Sektoren gelten werde,<br />
eventuell mit Ausnahmen für kleine<br />
und mittlere Unternehmen.<br />
Das Reutlinger Softwarehaus iPoint finanziert<br />
regelmäßig Studien und Projekte<br />
zu Due Diligence und nichtfinanzieller<br />
Berichterstattung. Damit und mit<br />
seinen auf dem Ansatz der Circular Economy<br />
aufsetzenden Softwarelösungen<br />
für Produkt-Compliance, Nachhaltigkeit,<br />
Risikomanagement- und Due-Diligence-<br />
Prozessen sowie zur Nachverfolgbarkeit<br />
des gesamten Produkt-Lebenszyklus<br />
und zur Lieferketten-Transparenz<br />
leistet iPoint einen Beitrag zu SDG 12<br />
(nachhaltige/r Konsum und Produktion).<br />
Vor allem tragen die Lösungen dazu bei,<br />
die ökologischen und sozialen Fußabdrücke<br />
von Unternehmen und Produkten<br />
sichtbar zu machen. Des Weiteren fördern<br />
iPoints Softwarelösungen auch die<br />
Erreichung von SDG 8 (menschenwürdige<br />
Arbeit und Wirtschaftswachstum)<br />
und SDG 9 (Industrie, Innovation und<br />
Infrastruktur).<br />
Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und<br />
Menschenrechte<br />
Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) wurden<br />
2011 vom UN-Menschenrechtsrat einstimmig angenommen. Die rechtlich nicht<br />
verbindlichen Prinzipien haben gleichwohl ihren Niederschlag in einer Vielzahl<br />
weiterer Initiativen und Rahmenwerke gefunden. Die UNGP werden durch drei<br />
Säulen bestimmt: Schutz der Menschenrechte, Achtung der Menschenrechte und<br />
Zugang zu Abhilfe. Beim Schutz der Menschenrechte wird vor allem der Staat<br />
angesprochen, während die zweite Säule sich insbesondere an Unternehmen<br />
wendet. Hier findet das Thema Due Diligence seinen Niederschlag. Die dritte<br />
Säule geht von einer geteilten Verantwortung von Staaten und Unternehmen<br />
aus. Staaten sollen gesetzliche und institutionelle Vorkehrungen treffen, damit<br />
Betroffene die Einhaltung der Menschenrechte einfordern können. Auch von<br />
Unternehmen wird erwartet, Beschwerdemöglichkeiten und gegebenenfalls<br />
auch Möglichkeiten zu schaffen, Wiedergutmachung für begangene<br />
Menschenrechtsverletzungen zu leisten.<br />
globalcompact <strong>Deutschland</strong> <strong>2020</strong><br />
93