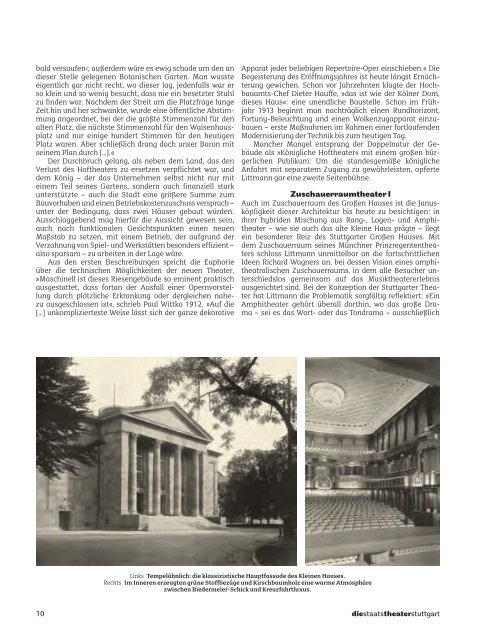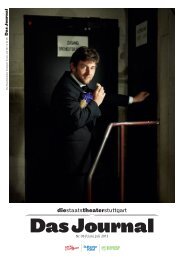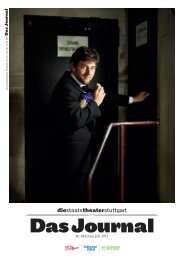UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ald versaufen‹; außerdem wäre es ewig schade um den an<br />
dieser Stelle gelegenen Botanischen Garten. Man wusste<br />
eigentlich gar nicht recht, wo dieser lag, jedenfalls war er<br />
so klein und so wenig besucht, dass nie ein besetzter Stuhl<br />
zu finden war. Nachdem der Streit um die Platzfrage lange<br />
Zeit hin und her schwankte, wurde eine öffentliche Abstimmung<br />
angeordnet, bei der die größte Stimmenzahl für den<br />
alten Platz, die nächste Stimmenzahl für den Waisenhausplatz<br />
und nur einige hundert Stimmen für den heutigen<br />
Platz waren. Aber schließlich drang doch unser Baron mit<br />
seinem Plan durch […].«<br />
Der Durchbruch gelang, als neben dem Land, das den<br />
Verlust des Hoftheaters zu ersetzen verpflichtet war, und<br />
dem König – der das Unternehmen selbst nicht nur mit<br />
einem Teil seines Gartens, sondern auch finanziell stark<br />
unterstützte – auch die Stadt eine größere Summe zum<br />
Bauvorhaben und einen Betriebskostenzuschuss versprach –<br />
unter der Bedingung, dass zwei Häuser gebaut würden.<br />
Ausschlaggebend mag hierfür die Aussicht gewesen sein,<br />
auch nach funktionalen Gesichtspunkten einen neuen<br />
Maßstab zu setzen, mit einem Betrieb, der aufgrund der<br />
Verzahnung von Spiel- und Werkstätten besonders effizient –<br />
also sparsam – zu arbeiten in der Lage wäre.<br />
Aus den ersten Beschreibungen spricht die Euphorie<br />
über die technischen Möglichkeiten der neuen Theater.<br />
»Maschinell ist dieses Riesengebäude so eminent praktisch<br />
ausgestattet, dass fortan der Ausfall einer Opernvorstellung<br />
durch plötzliche Erkrankung oder dergleichen nahezu<br />
ausgeschlossen ist«, schrieb Paul Wittko 1912. »Auf die<br />
[…] unkomplizierteste Weise lässt sich der ganze dekorative<br />
Apparat jeder beliebigen Repertoire-Oper einschieben.« <strong>Die</strong><br />
Begeisterung des Eröffnungsjahres ist heute längst Ernüchterung<br />
gewichen. Schon vor Jahrzehnten klagte der Hochbauamts-Chef<br />
<strong>Die</strong>ter Hauffe, »das ist wie der Kölner Dom,<br />
dieses Haus«: eine unendliche Baustelle. Schon im Frühjahr<br />
1913 beginnt man nachträglich einen Rundhorizont,<br />
Fortuny-Beleuchtung und einen Wolkenzugapparat einzubauen<br />
– erste Maßnahmen im Rahmen einer fortlaufenden<br />
Modernisierung der Technik bis zum heutigen Tag.<br />
Mancher Mangel entsprang der Doppelnatur der Gebäude<br />
als »Königliche Hoftheater« mit einem großen bürgerlichen<br />
Publikum: Um die standesgemäße königliche<br />
Anfahrt mit separatem Zugang zu gewährleisten, opferte<br />
Littmann gar eine zweite Seitenbühne.<br />
Zuschauerraumtheater I<br />
Auch im Zuschauerraum des Großen Hauses ist die Janusköpfigkeit<br />
dieser Architektur bis heute zu besichtigen: in<br />
ihrer hybriden Mischung aus Rang-, Logen- und Amphitheater<br />
– wie sie auch das alte Kleine Haus prägte – liegt<br />
ein besonderer Reiz des <strong>Stuttgart</strong>er Großen Hauses. Mit<br />
dem Zuschauerraum seines Münchner Prinzregententheaters<br />
schloss Littmann unmittelbar an die fortschrittlichen<br />
Ideen Richard Wagners an, bei dessen Vision eines amphitheatralischen<br />
Zuschauerraums, in dem alle Besucher unterschiedslos<br />
gemeinsam auf das Musiktheatererlebnis<br />
ausgerichtet sind. Bei der Konzeption der <strong>Stuttgart</strong>er Theater<br />
hat Littmann die Problematik sorgfältig reflektiert: »Ein<br />
Amphitheater gehört überall dorthin, wo das große Drama<br />
– sei es das Wort- oder das Tondrama – ausschließlich<br />
Links Tempelähnlich: die klassizistische Hauptfassade des Kleinen Hauses.<br />
Rechts Im Inneren erzeugten grüne Stoffbezüge und Kirschbaumholz eine warme Atmosphäre<br />
zwischen Biedermeier-Schick und Kreuzfahrtluxus.<br />
gepflegt werden soll, […] und […] ist schließlich da am Platze,<br />
wo […] alle Rang- und Klassenunterschiede fallen, und<br />
das demokratische Prinzip durch die Einheit der Plätze<br />
versinnbildlicht werden soll.« (Volkart gestaltete den<br />
Zuschauerraum des neuen Kleinen Hauses 1962 entgegen<br />
seiner ursprünglichen Intention in amphitheatralischer<br />
Sitzordnung.) Unmittelbar an das antike Amphitheater<br />
scheint Littmanns Vorgehensweise in der Planung des<br />
Hauses anzuschließen: der Orchestergraben bildete den<br />
Ausgangspunkt, seine Größe, ausgelegt auf 106 Musiker,<br />
wurde in einer Sitzprobe unter Aufsicht des damaligen Generalmusikdirektors<br />
Max von Schillings und des Komponisten<br />
Richard Strauss als erste festgelegt. Wie die Orchestra<br />
die Arena bestimmte der <strong>Stuttgart</strong>er Orchestergraben den<br />
Zuschauerraum. Neben den pragmatischen Gründen – ein<br />
Rangtheater fasst auf kleinerer Fläche mehr Zuschauer als<br />
ein Amphitheater – dürften nicht zuletzt gesellschaftliche<br />
Aspekte zu Littmanns »Zwischenlösung« geführt haben.<br />
Denn das Rangtheater ermöglicht »eine Teilung der Besucher,<br />
wo sie von höfischer Etikette oder gesellschaftlichen<br />
Einrichtungen verlangt wird«, zumal, wenn es wenigstens<br />
teilweise mit Logen versehen ist. »Und darin dürfte die<br />
Hauptursache liegen«, so Littmann, »die dem Rangtheater<br />
seine Daseinsberechtigung gibt und solange geben wird,<br />
als nicht unsere ganzen sozialen Verhältnisse geradezu radikale<br />
Umwandlungen erfahren haben.« Wie nahe diese radikalen<br />
Umwälzungen zu diesem Zeitpunkt bereits waren,<br />
konnte er nicht ahnen. Im Relief des Königspaares über der<br />
zentralen Tür im Foyer des ersten Ranges und ihren Initialen<br />
W(ilhelm) und CH(arlotte) in den Gittern der Balkon-<br />
brüstungen hat sich die alte Ordnung bis heute sichtbar<br />
in das Gebäude eingeschrieben, umspielt von der hellenischen<br />
Heiterkeit dionysischer Szenen.<br />
Pause: Foyertheater<br />
Vor allem der erste Rang mit seinen zweimal sieben Logen<br />
im hinteren Bereich, der zentralen königlichen Galaloge<br />
und den zwei Proszeniumslogen an den Seiten atmet wahlweise<br />
noch den Geist des feudalen Zeitalters, oder erinnert,<br />
wie Max Bächer kritisiert, »mit seinen Vorhängchen eher<br />
an zweifelhafte Chambres séparées«. Als Sensation empfanden<br />
die Zuschauer damals, dass die <strong>Stuttgart</strong>er Häuser<br />
selbst im Dritten Rang, in der »Zwetschgendörre«, ausschließlich<br />
Sitzplätze anboten. <strong>Die</strong> Garderobenbereiche,<br />
die auf den heutigen Besucher in ihrer Zurückgenommenheit<br />
wirken wie eine Schleuse auf dem Weg in den Saal, in<br />
der nach wie vor Schließerinnen mit schwerem Vierkantschlüssel<br />
ihren Abenddienst versehen, erschien den Besuchern<br />
des Jahres 1912 monumental: »Garderobenstände<br />
von einer Ausdehnung […] wie sie ein zweites deutsches<br />
Theater bisher wohl nicht kannte«, begeisterte sich Paul<br />
Wittko.<br />
Zuschauerraumtheater II<br />
Dass man das Aussehen und die Atmosphäre von Littmanns<br />
Entwurf bis heute erleben kann, ist nicht etwa Folge<br />
sorgfältiger Konservierung, sondern das Ergebnis restauratorischer<br />
Rekonstruktion: 1983/84 wurde der Zuschauerraum<br />
des Großen Hauses wieder in seinen Ursprungszustand<br />
versetzt, nachdem Jahrzehnte der modernisierenden<br />
Längsschnitt durch den Zuschauerraum des Großen Hauses.<br />
Entwurfsvariante, die bereits große Verwandtschaft zur Ausführung zeigt.<br />
10 Spielzeit 12/13 11