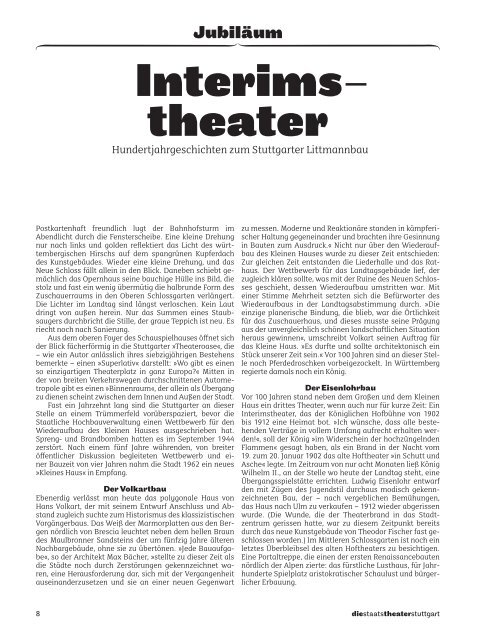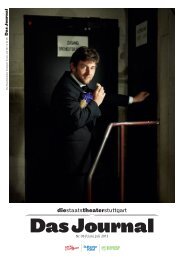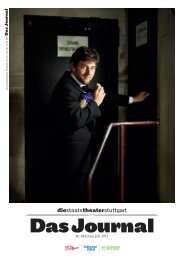UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Postkartenhaft freundlich lugt der Bahnhofsturm im<br />
Abendlicht durch die Fensterscheibe. Eine kleine Drehung<br />
nur nach links und golden reflektiert das Licht des württembergischen<br />
Hirschs auf dem spangrünen Kupferdach<br />
des Kunstgebäudes. Wieder eine kleine Drehung, und das<br />
Neue Schloss fällt allein in den Blick. Daneben schiebt gemächlich<br />
das Opernhaus seine bauchige Hülle ins Bild, die<br />
stolz und fast ein wenig übermütig die halbrunde Form des<br />
Zuschauerraums in den Oberen Schlossgarten verlängert.<br />
<strong>Die</strong> Lichter im Landtag sind längst verloschen. Kein Laut<br />
dringt von außen herein. Nur das Summen eines Staubsaugers<br />
durchbricht die Stille, der graue Teppich ist neu. Es<br />
riecht noch nach Sanierung.<br />
Aus dem oberen Foyer des Schauspielhauses öffnet sich<br />
der Blick fächerförmig in die <strong>Stuttgart</strong>er »Theateroase«, die<br />
– wie ein Autor anlässlich ihres siebzigjährigen Bestehens<br />
bemerkte – einen »Superlativ« darstellt: »Wo gibt es einen<br />
so einzigartigen Theaterplatz in ganz Europa?« Mitten in<br />
der von breiten Verkehrswegen durchschnittenen Autometropole<br />
gibt es einen »Binnenraum«, der allein als Übergang<br />
zu dienen scheint zwischen dem Innen und Außen der Stadt.<br />
Fast ein Jahrzehnt lang sind die <strong>Stuttgart</strong>er an dieser<br />
Stelle an einem Trümmerfeld vorüberspaziert, bevor die<br />
Staatliche Hochbauverwaltung einen Wettbewerb für den<br />
Wiederaufbau des Kleinen Hauses ausgeschrieben hat.<br />
Spreng- und Brandbomben hatten es im September 1944<br />
zerstört. Nach einem fünf Jahre währenden, von breiter<br />
öffentlicher Diskussion begleiteten Wettbewerb und einer<br />
Bauzeit von vier Jahren nahm die Stadt 1962 ein neues<br />
»Kleines Haus« in Empfang.<br />
Der Volkartbau<br />
Ebenerdig verlässt man heute das polygonale Haus von<br />
Hans Volkart, der mit seinem Entwurf Anschluss und Abstand<br />
zugleich suchte zum Historismus des klassizistischen<br />
Vorgängerbaus. Das Weiß der Marmorplatten aus den Bergen<br />
nördlich von Brescia leuchtet neben dem hellen Braun<br />
des Maulbronner Sandsteins der um fünfzig Jahre älteren<br />
Nachbargebäude, ohne sie zu übertönen. »Jede Bauaufgabe«,<br />
so der Architekt Max Bächer, »stellte zu dieser Zeit als<br />
die Städte noch durch Zerstörungen gekennzeichnet waren,<br />
eine Herausforderung dar, sich mit der Vergangenheit<br />
auseinanderzusetzen und sie an einer neuen Gegenwart<br />
Jubiläum<br />
Interims–<br />
theater<br />
Hundertjahrgeschichten zum <strong>Stuttgart</strong>er Littmannbau<br />
zu messen. Moderne und Reaktionäre standen in kämpferischer<br />
Haltung gegeneinander und brachten ihre Gesinnung<br />
in Bauten zum Ausdruck.« Nicht nur über den Wiederaufbau<br />
des Kleinen Hauses wurde zu dieser Zeit entschieden:<br />
Zur gleichen Zeit entstanden die Liederhalle und das Rathaus.<br />
Der Wettbewerb für das Landtagsgebäude lief, der<br />
zugleich klären sollte, was mit der Ruine des Neuen Schlosses<br />
geschieht, dessen Wiederaufbau umstritten war. Mit<br />
einer Stimme Mehrheit setzten sich die Befürworter des<br />
Wiederaufbaus in der Landtagsabstimmung durch. »<strong>Die</strong><br />
einzige planerische Bindung, die blieb, war die Örtlichkeit<br />
für das Zuschauerhaus, und dieses musste seine Prägung<br />
aus der unvergleichlich schönen landschaftlichen Situation<br />
heraus gewinnen«, umschreibt Volkart seinen Auftrag für<br />
das Kleine Haus. »Es durfte und sollte architektonisch ein<br />
Stück unserer Zeit sein.« Vor 100 Jahren sind an dieser Stelle<br />
noch Pferdedroschken vorbeigezockelt. In Württemberg<br />
regierte damals noch ein König.<br />
Der Eisenlohrbau<br />
Vor 100 Jahren stand neben dem Großen und dem Kleinen<br />
Haus ein drittes Theater, wenn auch nur für kurze Zeit: Ein<br />
Interimstheater, das der Königlichen Hofbühne von 1902<br />
bis 1912 eine Heimat bot. »Ich wünsche, dass alle bestehenden<br />
Verträge in vollem Umfang aufrecht erhalten werden!«,<br />
soll der König »im Widerschein der hochzüngelnden<br />
Flammen« gesagt haben, als ein Brand in der Nacht vom<br />
19. zum 20. Januar 1902 das alte Hoftheater »in Schutt und<br />
Asche« legte. Im Zeitraum von nur acht Monaten ließ König<br />
Wilhelm II., an der Stelle wo heute der Landtag steht, eine<br />
Übergangsspielstätte errichten. Ludwig Eisenlohr entwarf<br />
den mit Zügen des Jugendstil durchaus modisch gekennzeichneten<br />
Bau, der – nach vergeblichen Bemühungen,<br />
das Haus nach Ulm zu verkaufen – 1912 wieder abgerissen<br />
wurde. (<strong>Die</strong> Wunde, die der Theaterbrand in das Stadtzentrum<br />
gerissen hatte, war zu diesem Zeitpunkt bereits<br />
durch das neue Kunstgebäude von Theodor Fischer fast geschlossen<br />
worden.) Im Mittleren Schlossgarten ist noch ein<br />
letztes Überbleibsel des alten Hoftheaters zu besichtigen.<br />
Eine Portaltreppe, die einen der ersten Renaissancebauten<br />
nördlich der Alpen zierte: das fürstliche Lusthaus, für Jahrhunderte<br />
Spielplatz aristokratischer Schaulust und bürgerlicher<br />
Erbauung.<br />
Kleines Haus, Verwaltungsgebäude und Großes Haus: <strong>Die</strong> <strong>Stuttgart</strong>er Hoftheater-Anlage,<br />
aus der Vogelschau gesehen, Entwurf Max Littmann 1909/10.<br />
Bürgerliches Hoftheater<br />
Ihre Tradition als Theaterstadt verdankt <strong>Stuttgart</strong> ihren<br />
Fürsten. Zur Zeit des Herzogs Carl Eugen Mitte des 18. Jahrhunderts<br />
gelangte das Hoftheater zu seiner ersten Blüte.<br />
Anders als viele der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts<br />
aus bürgerlichem Gemeinsinn und Unterhaltungsbedürfnis<br />
entstandenen Theaterbauten gäbe es auch die <strong>Stuttgart</strong>er<br />
Neubauten wohl ohne den König in dieser Form nicht. <strong>Die</strong><br />
Hofbühne Wilhelms II. war eines der fortschrittlichsten<br />
Theater in Europa. Viele Werke, die andernorts der höfischen<br />
Zensur zum Opfer fielen – von Henrik Ibsen, Bjørnstjerne<br />
Bjørnson oder gar von Frank Wedekind – wurden in<br />
<strong>Stuttgart</strong> aufgeführt und mehr als einmal soll sich der<br />
preußische Kaiser Wilhelm II. über die laxe schwäbische<br />
Hofzensur geärgert haben. »Keinen geistigen Zwang duldete<br />
er an seiner Hofbühne, eingedenk der Tatsache, dass<br />
Schwaben es war, das den größten deutschen Vorkämpfer<br />
freien Geistesfluges, Schiller, geboren«, schrieb Hofrat<br />
Gerstmann über seinen König und das war nicht übertrieben.<br />
<strong>Die</strong> Wahl solcher Stoffe oblag dem Intendanten<br />
Joachim Gans Edler Herr zu Putlitz, einem badischen Offizier,<br />
der 1892 im Alter von nur 31 Jahren die Geschäfte des<br />
Königlichen Hoftheaters übernahm und diesen Beruf bis zur<br />
»Vertreibung« des Königs im November 1918 ausübte.<br />
Der Littmannbau<br />
Der Weg zum <strong>Stuttgart</strong>er Littmannbau führt nicht nur im<br />
symbolischen Sinn »über Putlitz«. Der Pfad von der Königstraße<br />
durch die Theaterpassage zu den <strong>Staatstheater</strong>n<br />
trägt seinen Namen. Putlitz war es, der den Münchner<br />
Architekten Max Littmann für <strong>Stuttgart</strong> entdeckte und<br />
mit ihm gemeinsam die Vision einer Doppeltheateranlage<br />
entwickelte. Ab 1902 befasste sich Littmann mit der<br />
Planung und ging schließlich 1908 auch erfolgreich aus<br />
dem Wettbewerb um den Neubau hervor. Das Münchner<br />
Prinzregententheater, eröffnet im Jahr 1901, war der erste<br />
Ausweis seiner »Theaterbegabung«, die sich in insgesamt<br />
elf Bauwerken manifestieren sollte. Darunter das Schillertheater<br />
in Berlin Charlottenburg (1905 – 06), das Großherzogliche<br />
Hoftheater in Weimar (1906 – 08), die Stadttheater<br />
in Hildesheim (1908 – 09), in Posen (1908 – 09) und in Bozen<br />
(1913 – 18). Sein Hauptwerk ist die <strong>Stuttgart</strong>er Theateranlage.<br />
<strong>Die</strong> Idee, einen Gebäudekomplex mit einem Großen<br />
und einem Kleinen Haus zu entwerfen entsprang einer Erfahrung,<br />
die Putlitz im Rahmen der Ausweichspielzeit des<br />
Jahres 1902 im Wilhelma-Theater gemacht hatte. »Trotz aller<br />
Mühe«, schreibt Putlitz, führte im alten Hoftheater »die<br />
Darstellung moderner und intimer Stücke nicht zu dem gewollten<br />
und gewünschten Erfolg. […] Ich musste erkennen,<br />
dass der kleine intime Rahmen des Kurtheaters das Geheimnis<br />
der Wirkung in sich trug«.<br />
Das Doppeltheater<br />
Mit seinem Plan, in <strong>Stuttgart</strong> ein Großes und ein Kleines<br />
Haus zu erbauen, erregte Putlitz, wie sich auch der<br />
Schauspieler Otto Miethke – Fach: Charakter-Komiker –<br />
erinnert, »bedenkliches Kopfschütteln«, nicht zuletzt aufgrund<br />
der Standortfrage für den 180 m breiten Gebäudekomplex:<br />
»Der heutige Platz wurde bemängelt: ›Der<br />
Nesenbach geht unten durch, und da würden die Theater<br />
8 Spielzeit 12/13 9