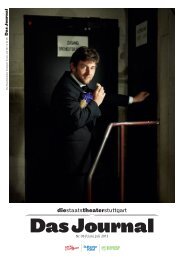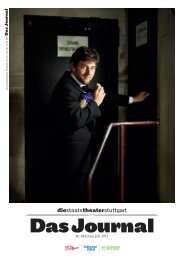UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Eingriffe und Nachbesserungen den Innenraum bis zur Unkenntlichkeit<br />
verändert hatten. Wie bei allen Veränderungen<br />
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bildeten auch<br />
bei diesen Maßnahmen technische Probleme den Ausgangspunkt<br />
aller Überlegungen. Es wurde ein Wettbewerb<br />
ausgelobt, in dem vier Probleme intensiv diskutiert wurden:<br />
Bühnenbeleuchtung, Akustik, historischer Bestand und –<br />
»die Büffetfrage«.<br />
Pause: Büffettheater<br />
Als »mehr als ärgerlich« empfand man bereits seit langer<br />
Zeit die Versorgungslage mit Essen und Getränken für die<br />
knapp 900 Gäste des Parketts und des ersten Ranges. Während<br />
die Gäste des zweiten und dritten Ranges mit Büffets<br />
versorgt waren, hatte Littmann, wie er notiert »wenigstens<br />
aus dem Foyersaal des Großen Hauses« den »einer Kunst-<br />
Stätte recht unwürdige[n] Wirtschaftsbetrieb entfernt«. <strong>Die</strong><br />
übrigen Gäste sollten in den Pausen den Weg in den Keller<br />
des Verwaltungsgebäudes suchen, wo – wie Paul Wittko<br />
1912 schreibt – »nach Apolls und seiner Musen splendiden<br />
Spenden, der Ceres und des Bacchus Gaben« winken. (<strong>Die</strong><br />
Speisezimmer hinter den Logen der königlichen Familie<br />
freilich verfügten über eine Küche mit der damals unvorstellbar<br />
modernen Einrichtung eines elektrischen Herds.)<br />
Gottfried Böhm, der vor allem für seine Sakralbauten berühmte<br />
Architekt, löste »die Büffetfrage« durch die Gestaltung<br />
eines Pavillons zwischen Großem Haus und Verwaltungstrakt.<br />
Der helle, zweistöckige Kuppelbau ist um ein<br />
rundes Büffet herum gebaut.<br />
Zuschauerraumtheater III<br />
Gravierender als dieser Anbau veränderte der Rückbau des<br />
Zuschauerraums den Charakter des Gebäudes. <strong>Die</strong> Architekten<br />
Paul Stohrer und Hans Paul Schmohl hatten 1956<br />
den gesamten Zuschauer- und Foyerbereich im Stile des<br />
Funktionalismus umgestaltet. <strong>Die</strong> »Entrümpelung«, auf<br />
der Bühne von Regisseuren wie Günter Rennert oder Wieland<br />
Wagner vorgenommen, fand ihre Entsprechung in den<br />
»<strong>Die</strong> Zukunft kann sich nur erfolgreich gestalten,<br />
wenn sie aus der Vergangenheit die richtigen Lehren zu ziehen weiß.«<br />
Unter dieser Maxime schufen Intendant Putlitz und Max Littmann<br />
die <strong>Stuttgart</strong>er Doppeltheateranlage.<br />
Veränderungen des Intérieurs. Der Stuck verschwand hinter<br />
Verschalungen, das Altgold der Wände wich einem lichten<br />
Weiß, dunkles Holz verschwand hinter Bespannungen<br />
und die Sessel wurden bis in den dritten Rang hinein neu<br />
verpolstert. Zu wenig hatte man offenbar die akustischen<br />
Konsequenzen dieses Handelns bedacht, denn in seiner<br />
Ausgabe vom 6. November 1957 berichtete ›Der Spiegel‹<br />
gewohnt skandalträchtig von einer schweren Krise des<br />
<strong>Stuttgart</strong>er Hauses: »Früher haben wir spielend gesungen,<br />
jetzt müssen wir schaffen wie die Gäule«, klagte der Wagner-Held<br />
Wolfgang Windgassen dem Journalisten sein<br />
Leid und drohte seinem Intendanten mit Kündigung. Man<br />
baute um, provisorisch.<br />
Seine vielgerühmte Akustik hat das <strong>Stuttgart</strong>er Große<br />
Haus erst nach seinem Rückbau 1984 wieder erhalten.<br />
Schwer wogen die Bedenken in diesem Fall bei den Bühnenbildnern,<br />
die das schlichte schwarze Portal, das seit<br />
1956 in <strong>Stuttgart</strong> den Blick auf das Bühnengeschehen<br />
konzentrierte, dem silbrigen Glanz des schmucken Littmann-Portals<br />
vorzogen. Regisseuren wie Achim Freyer,<br />
der beispielsweise im <strong>Stuttgart</strong>er Freischütz den Versuch<br />
unternahm, den Rahmen zum Verschwinden zu bringen,<br />
musste die Wiedereinsetzung des kassettierten Portals wie<br />
ein Rückfall in das 19. Jahrhundert erscheinen. Auch die<br />
»kalt-prächtige« Farbgebung des Zuschauerraums war bis<br />
zuletzt Gegenstand der Diskussion – und war es schon zwischen<br />
Baron Putlitz und seinem Architekten gewesen, wie<br />
Alexandrine Rossi – Staatsschauspielerin, Fach: Helden-<br />
mutter – sich erinnert. <strong>Die</strong>se erblickte »in festlicher Toilette«<br />
einmal ihren Intendanten »sehr erregt mit dem Professor<br />
Littmann sprechen und dabei immer ganz deutlich auf<br />
mich hinweisen […]; kein Zweifel, man beschäftigte sich mit<br />
meiner Person. Das Herz schlug mir bis an den Hals. Endlich<br />
fand ich den Mut, […] den Intendanten zu fragen: ›Habe<br />
ich meine Toilette schlecht gewählt, weil Sie, Herr Baron, so<br />
erregt auf mich zeigen?‹ ›Ach verzeihen Sie, liebes Fräulein<br />
Rossi, im Gegenteil, ich bin entzückt von den Farben: das<br />
blaue Samtkleid mit den herrlichen tiefroten Rosen wirkt<br />
so festlich, dass ich Littmann überreden möchte, für den<br />
Zuschauerraum des Großen Hauses diese warmen Töne zu<br />
wählen. Aber er bleibt bei seiner künstlerischen Überzeugung.<br />
Sonnenleuchtendes Gelb mit Silber.‹«<br />
Groß und Klein<br />
Nachhaltigsten Einfluss auf die Architektur der <strong>Staatstheater</strong><br />
<strong>Stuttgart</strong> hatten aber wohl nicht bauliche, sondern<br />
organisatorische Veränderungen. <strong>Die</strong> gemeinsam mit Littmann<br />
verwirklichte Theatervision des Baron von Putlitz<br />
sah keineswegs eine Trennung der Sparten auf das Große<br />
(Opern-) und das Kleine (Schauspiel-)Haus vor: Im Kleinen<br />
Haus erklangen nicht nur erstmals moderne Dramen,<br />
es bot gleichermaßen den Opern von Wolfgang Amadeus<br />
Mozart den adäquaten Rahmen und erlebte die Erstaufführung<br />
der Urfassung der Ariadne von Richard Strauss.<br />
Umgekehrt war das Große Haus nicht nur Schauplatz großer<br />
Opern, sondern auch der »Staatsaktionen« von Goethe<br />
oder Schiller. »Ein Haus, das für die Tonmassen einer mit<br />
hundert und mehr Musikern besetzten Ring-Aufführung<br />
gebaut ist, kann unmöglich für Così fan tutte sich eignen,<br />
und ein Haus, in dem Scribes Das Glas Wasser zu künstlerischer<br />
Wirkung gelangt, würde erdrückend sein für die<br />
Shakespeare’schen Königsdramen«, schreibt Max Littmann<br />
mit Verweis auf die Nutzung des Cuvilliés- und des Nationaltheaters<br />
in München. Von dieser ursprünglichen Nutzung<br />
der beiden Theater für Schauspiel und Musiktheater erzählen<br />
immer noch die weißen Hermen im Prunkfoyer des<br />
Großen Hauses, wo neben Mozart, Beethoven und Wagner<br />
auch Shakespeare, Schiller und Goethe ihre goldene Nische<br />
»bewohnen«. Bereits in der Spielzeit 1919/20 wird die<br />
Trennung der Spielbetriebe zwischen Oper und Schauspiel<br />
weitgehend vollzogen und nur noch gelegentlich<br />
aufgebrochen. Inzwischen nutzt allein das <strong>Stuttgart</strong>er<br />
Ballett beide Häuser gleichermaßen: mit Uraufführungen<br />
und herausfordernden neuen Werken im intimeren Schauspielhaus,<br />
mit sinfonischen, vom Staatsorchester begleiteten<br />
Handlungsballetten im Opernhaus. Im Kammertheater<br />
1902<br />
Januar: Brand des Königlichen<br />
Hoftheaters, hervorgegangen aus dem<br />
1584 erbauten Neuen Lusthaus<br />
1902<br />
April bis Dezember: Bau des<br />
Interimstheaters, entworfen von<br />
Ludwig Eisenlohr<br />
1908 – 12<br />
Bau der Doppeltheateranlage,<br />
entworfen von Max Littmann<br />
1912<br />
Einweihung des Großen und Kleinen<br />
Hauses der Königlichen Hoftheater<br />
am 14. und 15. September<br />
1944<br />
Das Kleine Haus wird durch Bombenangriffe<br />
zerstört<br />
1956<br />
Umgestaltung der Inneneinrichtung<br />
des Großen Hauses durch Paul Stohrer<br />
und Hans Paul Schmohl<br />
1959 – 62<br />
Bau des neuen Kleinen Hauses,<br />
entworfen von Hans Volkart<br />
in der Staatsgalerie teilen sich Schauspiel, Ballett und<br />
(Junge) Oper seit 1983 eine kleine Nebenspielstätte, die<br />
eine noch größere Nähe zum Zuschauer zulässt.<br />
Interim<br />
Wie eine Krone umspielen die zehn Skulpturen vor dem<br />
klassizistischen Dreieck des Bühnenturms die Attika des<br />
Großen Hauses. Sie verkörpern Plastik, Architektur, Technik,<br />
Dramatik, Mimik, Gesang, Lyrik, Musik, Schauspielkunst<br />
und Malerei. Es sind mehr Figuren, als die Antike<br />
Musen kennt, und doch zu wenige um alle Fertigkeiten zu<br />
symbolisieren, die unter dem Dach der <strong>Staatstheater</strong> <strong>Stuttgart</strong><br />
versammelt sind. Schon seit der Bundesgartenschau<br />
des Jahres 1961 spiegeln sie sich nicht mehr im von Nymphen<br />
umrahmten Oval des Schwanenteichs, den Nikolaus<br />
von Thouret zu Beginn des 19. Jahrhunderts hier anlegte,<br />
sondern in den asymmetrischen Linien des Eckensees.<br />
<strong>Die</strong> Wandlungen und Umbauten, welche die <strong>Stuttgart</strong>er<br />
Doppeltheateranlage in den vergangenen 100 Jahren<br />
erfahren hat, scheinen zu unterstreichen, dass der Zustand<br />
des Interims nicht von der Errichtung eines Gebäudes abhängig<br />
ist. So schrieb der jüdische Dramatiker Julius Bab in<br />
einem Grußwort anlässlich der Eröffnung der <strong>Staatstheater</strong><br />
1912: »Ich habe die <strong>Stuttgart</strong>er Hofbühne nur im Interimhause<br />
kennen gelernt; aber dass ihr in jedem Heim dies<br />
köstlich lebenspendende Interim, dies mutige Dazwischensein<br />
zwischen gestern und morgen in lebendigster Gegenwart<br />
erhalten bleibe, das ist mein herzlichster Wunsch.«<br />
Der Sternenhimmel Julius Mössels an der Decke des<br />
Zuschauerraums des Großen Hauses ist vielleicht weniger<br />
eine melancholische Erinnerung an die antiken Festspiele<br />
unter freiem Himmel, als eine Mahnung, dass Theater,<br />
Tanz und Musik in unseren Graden nicht allein aufgrund<br />
der Witterungsverhältnisse ohne Dach nicht möglich wären.<br />
Sie benötigen für ihre flüchtige Erscheinung Häuser<br />
aus Stein. Mögen Jahrhunderte darüber hinweggehen. Das<br />
Ephemere bleibt.<br />
Patrick Hahn<br />
1983<br />
Einweihung des Kammertheaters in<br />
der Staatsgalerie<br />
1984<br />
Einweihung des nach Littmanns<br />
Originalplänen rekonstruierten<br />
Großen Hauses und des Pavillons<br />
von Gottfried Böhm<br />
2001<br />
Umbenennung der Gebäude in<br />
Opernhaus und Schauspielhaus<br />
2011<br />
Sanierung des Schauspielhauses,<br />
nicht abgeschlossen<br />
12 Spielzeit 12/13 13<br />
Chronik