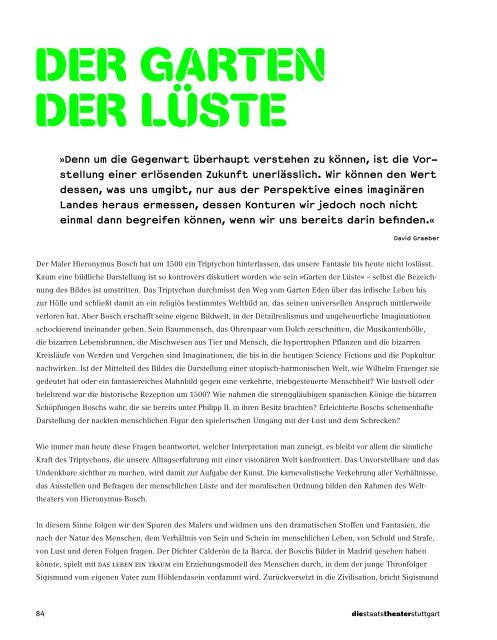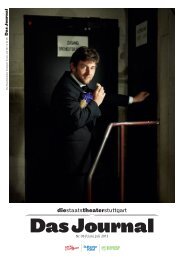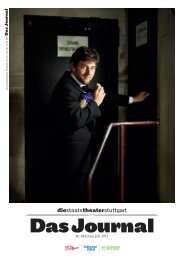UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
UraUF - Die Staatstheater Stuttgart
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
der garten<br />
der lüste<br />
»Denn um die Gegenwart überhaupt verstehen zu können, ist die Vorstellung<br />
einer erlösenden Zukunft unerlässlich. wir können den wert<br />
dessen, was uns umgibt, nur aus der Perspektive eines imaginären<br />
landes heraus ermessen, dessen konturen wir jedoch noch nicht<br />
einmal dann begreifen können, wenn wir uns bereits darin befinden.«<br />
David Graeber<br />
Der Maler Hieronymus Bosch hat um 1500 ein Triptychon hinterlassen, das unsere Fantasie bis heute nicht loslässt.<br />
Kaum eine bildliche Darstellung ist so kontrovers diskutiert worden wie sein »Garten der Lüste« – selbst die Bezeichnung<br />
des Bildes ist umstritten. Das Triptychon durchmisst den Weg vom Garten Eden über das irdische Leben bis<br />
zur Hölle und schließt damit an ein religiös bestimmtes Weltbild an, das seinen universellen Anspruch mittlerweile<br />
verloren hat. Aber Bosch erschafft seine eigene Bildwelt, in der Detailrealismus und ungeheuerliche Imaginationen<br />
schockierend ineinander gehen. Sein Baummensch, das Ohrenpaar vom Dolch zerschnitten, die Musikantenhölle,<br />
die bizarren Lebensbrunnen, die Mischwesen aus Tier und Mensch, die hypertrophen Pflanzen und die bizarren<br />
Kreisläufe von Werden und Vergehen sind Imaginationen, die bis in die heutigen Science Fictions und die Popkultur<br />
nachwirken. Ist der Mittelteil des Bildes die Darstellung einer utopisch-harmonischen Welt, wie Wilhelm Fraenger sie<br />
gedeutet hat oder ein fantasiereiches Mahnbild gegen eine verkehrte, triebgesteuerte Menschheit? Wie lustvoll oder<br />
belehrend war die historische Rezeption um 1500? Wie nahmen die strenggläubigen spanischen Könige die bizarren<br />
Schöpfungen Boschs wahr, die sie bereits unter Philipp II. in ihren Besitz brachten? Erleichterte Boschs schemenhafte<br />
Darstellung der nackten menschlichen Figur den spielerischen Umgang mit der Lust und dem Schrecken?<br />
Wie immer man heute diese Fragen beantwortet, welcher Interpretation man zuneigt, es bleibt vor allem die sinnliche<br />
Kraft des Triptychons, die unsere Alltagserfahrung mit einer visionären Welt konfrontiert. Das Unvorstellbare und das<br />
Undenkbare sichtbar zu machen, wird damit zur Aufgabe der Kunst. <strong>Die</strong> karnevalistische Verkehrung aller Verhältnisse,<br />
das Ausstellen und Befragen der menschlichen Lüste und der moralischen Ordnung bilden den Rahmen des Welttheaters<br />
von Hieronymus Bosch.<br />
In diesem Sinne folgen wir den Spuren des Malers und widmen uns den dramatischen Stoffen und Fantasien, die<br />
nach der Natur des Menschen, dem Verhältnis von Sein und Schein im menschlichen Leben, von Schuld und Strafe,<br />
von Lust und deren Folgen fragen. Der Dichter Calderón de la Barca, der Boschs Bilder in Madrid gesehen haben<br />
könnte, spielt mit das leben ein traum ein Erziehungsmodell des Menschen durch, in dem der junge Thronfolger<br />
Sigismund vom eigenen Vater zum Höhlendasein verdammt wird. Zurückversetzt in die Zivilisation, bricht Sigismund<br />
alle Konvention, er tötet, aber was ist es, das da in ihm ausbricht? Ist es die ›menschliche Natur‹ oder eine fehlgeleitete<br />
Sozialisation? Regisseur Sebastian Baumgarten greift mit Calderóns Stück erneut ein philosophisches Drama auf.<br />
Skandalös und komisch zugleich ist in seiner Entstehungszeit Molières tartuffe wahrgenommen worden. Das Bloß-<br />
legen der ethisch-religiösen Unaufrichtigkeit, des Scheins einer moralischen Integrität, taugt heute immer noch zum<br />
Spektakel, vor allem wenn es um Figuren des öffentlichen Lebens geht. Claudia Bauer inszeniert diesen Molière-<br />
Klassiker.<br />
Neben diesen großen Texten der Weltliteratur werden sich eine Vielzahl von Uraufführungen mit dem Garten der<br />
Lüste in Bezug setzen. In ein vermeintliches Südsee-Paradies reisen vier deutsche Touristen, um der Tristesse des<br />
Alltagslebens zu entfliehen – so ist die Ausgangssituation in Sibylle Bergs neuem Stück angst reist mit. Aber die<br />
vier schleppen die zivilisatorischen Ansprüche und die selbstzerstörerischen Potentiale unserer konsumbesessenen<br />
Gesellschaft mit – das Paradies wird zum Höllentrip. Hasko Weber inszeniert die neue ›Freizeitoper‹, die Sibylle Berg<br />
für das schauspiel stuttgart geschrieben hat. Mit der Sehnsucht nach dem Paradies beschäftigt sich auch der<br />
Autor und Regisseur Jan Neumann, der die klassische Konstellation – Adam, Eva und ein ›Drittes‹ – zur Grundlage<br />
seiner neuen Stückentwicklung störenfriede (arbeitstitel) im nord macht.<br />
Regisseur Stephan Kimmig präsentiert mit stallerhof von Franz Xaver Kroetz und der Uraufführung von Stephan<br />
Kaluzas 3d zwei Stücke, in denen sexuelle Gewalt zur destruktiven Triebkraft wird und das Leben in der Familie zur<br />
Tortur. Eine Welt zwischen Himmel und Hölle – die internationale Finanzwelt – schildert Andres Veiels dokumentarisches<br />
Theaterstück das himbeerreich.<br />
Zu den Lüsten und Begierden gehört auch das Essen. Kein Fernsehtag vergeht ohne Kochshow, über nichts reden<br />
wir so gern wie über das Essen und Trinken. Mit den grotesken Verzerrungen dieses Teils unseres Alltags – früher<br />
als die Todsünde ›Völlerei‹ bekannt – wie mit den gesellschaftlichen Dimensionen der modernen Nahrungsmittelherstellung<br />
und -verschwendung beschäftigt sich Volker Lösch in seiner Inszenierung großes fressen.<br />
Eröffnet wird die Spielzeit im nord mit der Uraufführung von salmans kopf des Autorenduos Brüder Presnjakow,<br />
inszeniert von Catja Baumann, die als Künstlerische Leiterin das nord zwei Jahre lang erfolgreich geführt hat. <strong>Die</strong><br />
Presnjakows greifen im Stile Gogols auf das Mittel der Groteske zurück, um die Verzerrungen menschlichen Verhaltens<br />
durchzuspielen. In der karnevalistischen Verdrehung des Stücks sind es nicht religiöse Fundamentalisten, die Salman<br />
Rushdies Kopf fordern, sondern seine eigene Familie.<br />
<strong>Die</strong> diesjährigen Uraufführungen – zu denen auch die neuen Stücke von René Pollesch und Rimini-Protokoll gehören –<br />
setzen Boschs »Garten der Lüste« in den Kontext der Gegenwart, sie sind unser theatralischer Zerrspiegel, unser Kalei-<br />
doskop der Wirklichkeit.<br />
JörG boChow<br />
Chefdramaturg<br />
84 Schauspiel <strong>Stuttgart</strong> 12/13 85