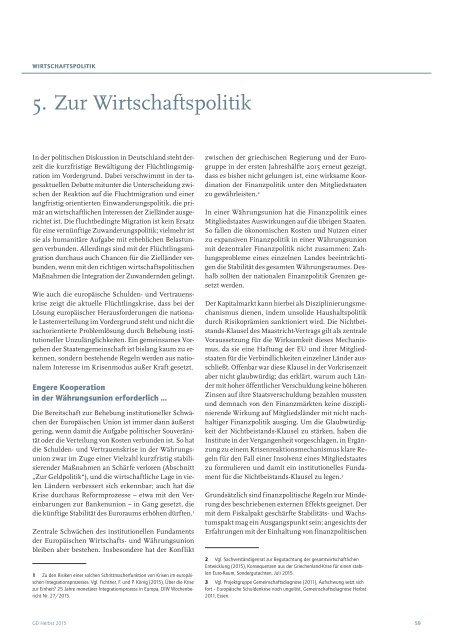Gemeinschafts- diagnose
20151008_gd_herbst_gutachten
20151008_gd_herbst_gutachten
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Wirtschaftspolitik<br />
5. Zur Wirtschaftspolitik<br />
In der politischen Diskussion in Deutschland steht derzeit<br />
die kurzfristige Bewältigung der Flüchtlingsmigration<br />
im Vordergrund. Dabei verschwimmt in der tagesaktuellen<br />
Debatte mitunter die Unterscheidung zwischen<br />
der Reaktion auf die Fluchtmigration und einer<br />
langfristig orientierten Einwanderungspolitik, die primär<br />
an wirtschaftlichen Interessen der Zielländer ausgerichtet<br />
ist. Die fluchtbedingte Migration ist kein Ersatz<br />
für eine vernünftige Zuwanderungspolitik; vielmehr ist<br />
sie als humanitäre Aufgabe mit erheblichen Belastungen<br />
verbunden. Allerdings sind mit der Flüchtlingsmigration<br />
durchaus auch Chancen für die Zielländer verbunden,<br />
wenn mit den richtigen wirtschaftspolitischen<br />
Maßnahmen die Integration der Zuwandernden gelingt.<br />
Wie auch die europäische Schulden- und Vertrauenskrise<br />
zeigt die aktuelle Flüchtlingskrise, dass bei der<br />
Lösung europäischer Herausforderungen die nationale<br />
Lastenverteilung im Vordergrund steht und nicht die<br />
sachorientierte Problemlösung durch Behebung institutioneller<br />
Unzulänglichkeiten. Ein gemeinsames Vorgehen<br />
der Staatengemeinschaft ist bislang kaum zu erkennen,<br />
sondern bestehende Regeln werden aus nationalem<br />
Interesse im Krisenmodus außer Kraft gesetzt.<br />
Engere Kooperation<br />
in der Währungsunion erforderlich …<br />
Die Bereitschaft zur Behebung institutioneller Schwächen<br />
der Europäischen Union ist immer dann äußerst<br />
gering, wenn damit die Aufgabe politischer Souveränität<br />
oder die Verteilung von Kosten verbunden ist. So hat<br />
die Schulden- und Vertrauenskrise in der Währungsunion<br />
zwar im Zuge einer Vielzahl kurzfristig stabilisierender<br />
Maßnahmen an Schärfe verloren (Abschnitt<br />
„Zur Geldpolitik“), und die wirtschaftliche Lage in vielen<br />
Ländern verbessert sich erkennbar; auch hat die<br />
Krise durchaus Reformprozesse – etwa mit den Vereinbarungen<br />
zur Bankenunion – in Gang gesetzt, die<br />
die künftige Stabilität des Euroraums erhöhen dürften. 1<br />
Zentrale Schwächen des institutionellen Fundaments<br />
der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion<br />
bleiben aber bestehen. Insbesondere hat der Konflikt<br />
1 Zu den Risiken einer solchen Schrittmacherfunktion von Krisen im europäischen<br />
Integrationsprozesses. Vgl. Fichtner, F. und P. König (2015), Über die Krise<br />
zur Einheit? 25 Jahre monetärer Integrationsprozess in Europa, DIW Wochenbericht<br />
Nr. 27/2015.<br />
zwischen der griechischen Regierung und der Eurogruppe<br />
in der ersten Jahreshälfte 2015 erneut gezeigt,<br />
dass es bisher nicht gelungen ist, eine wirksame Koordination<br />
der Finanzpolitik unter den Mitgliedstaaten<br />
zu gewährleisten. 2<br />
In einer Währungsunion hat die Finanzpolitik eines<br />
Mitgliedstaates Auswirkungen auf die übrigen Staaten.<br />
So fallen die ökonomischen Kosten und Nutzen einer<br />
zu expansiven Finanzpolitik in einer Währungsunion<br />
mit dezentraler Finanzpolitik nicht zusammen: Zahlungsprobleme<br />
eines einzelnen Landes beeinträchtigen<br />
die Stabilität des gesamten Währungsraumes. Deshalb<br />
sollten der nationalen Finanzpolitik Grenzen gesetzt<br />
werden.<br />
Der Kapitalmarkt kann hierbei als Disziplinierungsmechanismus<br />
dienen, indem unsolide Haushaltspolitik<br />
durch Risikoprämien sanktioniert wird. Die Nichtbeistands-Klausel<br />
des Maastricht-Vertrags gilt als zentrale<br />
Voraussetzung für die Wirksamkeit dieses Mechanismus,<br />
da sie eine Haftung der EU und ihrer Mitgliedstaaten<br />
für die Verbindlichkeiten einzelner Länder ausschließt.<br />
Offenbar war diese Klausel in der Vorkrisenzeit<br />
aber nicht glaubwürdig; das erklärt, warum auch Länder<br />
mit hoher öffentlicher Verschuldung keine höheren<br />
Zinsen auf ihre Staatsverschuldung bezahlen mussten<br />
und demnach von den Finanzmärkten keine disziplinierende<br />
Wirkung auf Mitgliedsländer mit nicht nachhaltiger<br />
Finanzpolitik ausging. Um die Glaubwürdigkeit<br />
der Nichtbeistands-Klausel zu stärken, haben die<br />
Institute in der Vergangenheit vorgeschlagen, in Ergänzung<br />
zu einem Krisenreaktionsmechanismus klare Regeln<br />
für den Fall einer Insolvenz eines Mitgliedstaates<br />
zu formulieren und damit ein institutionelles Fundament<br />
für die Nichtbeistands-Klausel zu legen. 3<br />
Grundsätzlich sind finanzpolitische Regeln zur Minderung<br />
des beschriebenen externen Effekts geeignet. Der<br />
mit dem Fiskalpakt geschärfte Stabilitäts- und Wachstumspakt<br />
mag ein Ausgangspunkt sein; angesichts der<br />
Erfahrungen mit der Einhaltung von finanzpolitischen<br />
2 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen<br />
Entwicklung (2015), Konsequenzen aus der Griechenland-Krise für einen stabilen<br />
Euro-Raum, Sondergutachten, Juli 2015.<br />
3 Vgl. Projektgruppe <strong>Gemeinschafts</strong><strong>diagnose</strong> (2011), Aufschwung setzt sich<br />
fort – Europäische Schuldenkrise noch ungelöst, <strong>Gemeinschafts</strong><strong>diagnose</strong> Herbst<br />
2011, Essen.<br />
GD Herbst 2015<br />
59