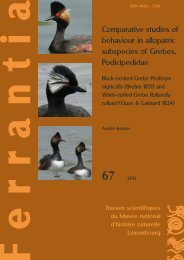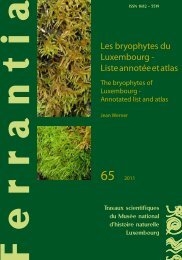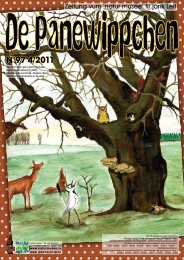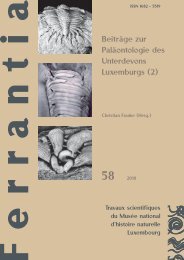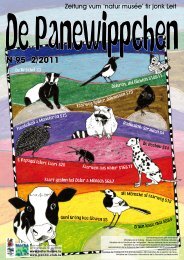Die Höhlenfauna Luxemburgs - Musée national d'histoire naturelle
Die Höhlenfauna Luxemburgs - Musée national d'histoire naturelle
Die Höhlenfauna Luxemburgs - Musée national d'histoire naturelle
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
D. Weber <strong>Die</strong> <strong>Höhlenfauna</strong> <strong>Luxemburgs</strong><br />
auch wenn der Pflanzenbewuchs schon stark<br />
reduziert ist. Es sind vor allem eutrogloxene Arten<br />
zu erwarten. Der Bereich ist taghell und entspricht<br />
der Eingangsregion nach Dobat (1966) und Weber<br />
(1988d, 1989, 1995, 2001).<br />
Das zweite Intervall ist der von 2-5 m vom Trauf.<br />
Es ist meist schon leicht abgedunkelt. Es fällt damit<br />
oft schon in die Übergangsregion nach Dobat (1966)<br />
und Weber (1988d, 1989, 1995, 2001). Eine Ausnahme<br />
bilden Bahntunnel, bei denen das Intervall von 2-5 m<br />
noch zur Eingangsregion gezählt wird.<br />
Weiter wurde grundsätzlich in 5-m-Intervalle unterteilt.<br />
Der Übergang zur Tiefenregion nach Dobat<br />
(1966) und Weber (1988d, 1989, 1995, 2001), also dem<br />
völligen Dunkel, ist recht willkürlich. Ist 50 m nach<br />
dem Trauf noch kein völliges Dunkel erreicht, so<br />
wird bei 50 m die Grenze von Übergangs- zur Tiefenregion<br />
definiert, da andere Faktoren das Leben in<br />
der Höhle stärker beeinflussen als die geringe Lichtmenge.<br />
Eine Ausnahme bilden hier wiederum die<br />
Bahntunnel, bei denen die Grenze von Übergangszur<br />
Tiefenregion bei 100 m festgesetzt wird.<br />
Bei sehr großen Objekten wurde die Besammlung<br />
abgebrochen, sobald zu erwarten war, dass sich in<br />
der Faunenzusammensetzung nichts mehr ändert.<br />
Ferrantia • 69 / 2013<br />
<strong>Die</strong> Sammlung erfolgte so, dass Wände und Boden,<br />
ggf. auch die Höhlendecke, visuell abgesucht<br />
wurden. Insbesondere wurde organisches Material<br />
intensiv untersucht. <strong>Die</strong> gesehenen Tiere wurden<br />
mittels eines feuchten Pinsels in Konservierflüssigkeit<br />
(70% Isopropanol) überführt.<br />
Kleine und wenig lohnende Objekte wurden nur<br />
einmal besammelt. Bedeutende Höhlen wurden<br />
jedoch innerhalb eines Jahres viermal besammelt,<br />
zu jeder Jahreszeit einmal. So kann man herausfinden,<br />
welche Tiere in welcher Jahreszeit die<br />
Höhlen besiedeln, was wiederum Rückschlüsse auf<br />
die ökologische Zuordnung der Art erlaubt.<br />
Vergleicht man die Anzahl der bei Handaufsammlungen<br />
getätigten Funde mit der Anzahl der besammelten<br />
Bereiche, so bekommt man einen guten<br />
Eindruck über die Abundanz im Höhleninnern.<br />
7.2 Fallenfunde<br />
In den meisten Höhlen wurden Barberfallen<br />
aufgestellt. Polystyrol-Gefäße von 10 cm Länge, 5<br />
cm Breite und 5 cm Tiefe wurden in den Boden<br />
eingegraben und halb mit Ethan-diol-1,2 gefüllt.<br />
Abb. 66: Der Autor beim Handaufsammeln in der Minn vun Asselbuer. Foto: Harbusch.<br />
83