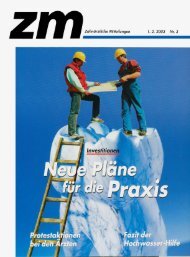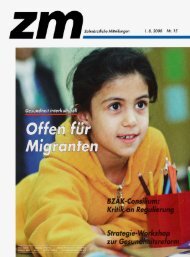Editorial 17 - Zm-online
Editorial 17 - Zm-online
Editorial 17 - Zm-online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
35<br />
handlungsalternativen vorschlagen<br />
und die individuellen Lebensumstände<br />
mit einbeziehen.<br />
Wenn es allerdings an die Therapieentscheidung<br />
geht, sieht die<br />
Sache schon anders aus: Nur in<br />
30 bis 40 Prozent der Fälle werden<br />
die Patienten hier beteiligt –<br />
ein „ungenügender Anteil“, so<br />
das Urteil des „Gesundheitsmonitors“.<br />
Tiefes Misstrauen: Patienten erwarten „nur Schlimmes”.<br />
Aber warum?<br />
Patientenbeteiligung sei nicht nur „eine zunehmende<br />
medizinische Notwendigkeit“,<br />
sondern auch „erklärtes Interesse beider<br />
Seiten“. Allerdings sei das, was in der Theorie<br />
gewollt ist, bislang noch nicht konsequent<br />
Da ein Patient die Notwendigkeit einer Wiederholungsuntersuchung<br />
in der Regel fachlich<br />
nicht beurteilen könne, müsse man fragen,<br />
wie er zu diesem Urteil kommt. Laut<br />
Borgers liegt ein möglicher Grund für diese<br />
in die Praxis umgesetzt. „Die relativ Zweifel darin, dass Patienten „einen<br />
starke Verbreitung eines Dissenses in Behandlungsfragen<br />
gibt für sich allein betrachtet<br />
noch keinen Grund, am Funktionieren<br />
der Arzt-Patienten-Kommunikation<br />
zu zweifeln“, so die Autoren. Problematisch<br />
sei vielmehr, dass rund zehn Prozent der<br />
vom „Gesundheitsmonitor“ befragten Patienten<br />
es verschweigen, wenn sie einen<br />
Behandlungsvorschlag des Arztes eigentlich<br />
ablehnen. „Solche Vorgänge gefährden<br />
das notwendige Vertrauensverhältnis und<br />
letztlich den Behandlungserfolg“, meinen<br />
Streich, Klemperer und Butzlaff.<br />
schlechten Eindruck von der kollegialen<br />
Kommunikation zwischen den behandelnden<br />
Ärzten“ haben.<br />
Es stelle sich hier die Frage, ob die Verbesserung<br />
an den so genannten „Schnittstellen“<br />
zwischen ambulanter und stationärer Behandlung<br />
zu einer Verbesserung der Versorgung<br />
führen könne. Eine rein technische<br />
Aufrüstung der Kommunikationsmöglichkeiten<br />
– beispielsweise per elektronischer<br />
Krankenakte – ist nach Ansicht des „Gesundheitsmonitors“<br />
jedoch kein probates<br />
Mittel, um Mehrfachuntersuchungen zu<br />
drosseln. Denn wenn es sich hierbei um ein<br />
rein technisches Problem hielte, gäbe es<br />
Doppelt gedoktert<br />
Nach Beobachtung von Prof. Dr. Dieter<br />
Borgers vom Universitätsklinikum Düsseldorf<br />
werden aber auch durch Kommunikationsdefizite<br />
an anderer Stelle im Gesundheitssystem<br />
Ressourcen vergeudet. Gemeint<br />
sind Doppeluntersuchungen bei Behandlungen,<br />
an denen unterschiedliche<br />
Ärzte beteiligt sind. Rund ein Viertel der<br />
vom „Gesundheitsmonitor“ befragten Patienten<br />
war im zurückliegenden Jahr ambulant<br />
bei mehreren Ärzten in Behandlung;<br />
hiervon haben knapp 40 Prozent „eine Wiederholung<br />
von Untersuchungen erlebt“ –<br />
Blutentnahmen, Blutdruckmessungen oder<br />
Röntgenuntersuchungen. Zwei Drittel der<br />
Patienten sind zwar der Meinung, die Wiederholungen<br />
seien notwendig gewesen.<br />
Aber immerhin jeder Siebte ist sich sicher:<br />
Sie waren unnötig.<br />
Patient und Arzt: Partnerschaft statt<br />
Paternalismus<br />
Foto: EyeWire<br />
heutzutage bereits genügend<br />
Möglichkeiten, um es aus dem<br />
Weg zu räumen – von Telefon<br />
über Fax bis zur E-Mail.<br />
Wie sehr sich die Wahrnehmung<br />
von Patient und Arzt unterscheiden<br />
kann, zeigt sich an einem<br />
klaren Beispiel des „Gesundheitsmonitors“:<br />
Danach liegt aus<br />
Sicht der Krankenversicherten in<br />
Deutschland das derzeit größte<br />
Problem im Gesundheitswesen nicht in den<br />
Kosten, sondern in der unterschiedlichen<br />
Qualität der einzelnen Ärzte. Nach Ansicht<br />
der breiten Bevölkerung, so der „Gesundheitsmonitor“,<br />
müsse demnach eine Debatte<br />
um Qualität und Effizienz im Gesundheitswesen<br />
geführt werden, da die Kostendämpfungspolitik<br />
der vergangenen<br />
Jahre „allenfalls zu kurzfristigen Effekten<br />
geführt und damit ihre Glaubwürdigkeit<br />
verloren hat“.<br />
Allen kleinen Unstimmigkeiten und Gegensätzlichkeiten<br />
zum Trotz: Es gibt nach<br />
wie vor einen breiten Konsens für das Solidarprinzip<br />
in der Gesetzlichen Krankenversicherung.<br />
Rund 80 Prozent aller Befragten<br />
stimmen der Unterstützung älterer und<br />
kranker Menschen durch jüngere und gesunde<br />
uneingeschränkt zu; und zwar sowohl<br />
„Nutznießer“ als auch „Geber“. Die<br />
„solidarische Unterstützung kinderreicher<br />
Familien“ durch „kinderlose Singles“ wird<br />
von etwas mehr als 60 Prozent für gerecht<br />
gehalten. „Eine flächendeckende Einführung<br />
privater Risikovorsorge in der Krankenversicherung“,<br />
so der Tenor, „findet nur<br />
bei einer sehr kleinen Minderheit Zustimmung.“<br />
Immerhin: Die Einführung von<br />
Grund- und Wahlleistungen stößt bei jedem<br />
Dritten auf Sympathie.<br />
Und eines verschweigt der „Gesundheitsmonitor“<br />
genauso wenig wie es die<br />
Zahnärzteschaft bereits seit längerem tut.<br />
Die „hektische“ und „intransparente“ Budget-<br />
und Kostendämpfungspolitik im Gesundheitswesen<br />
hat zu einem tiefen Misstrauen<br />
der Deutschen geführt: Zwischen 60<br />
und 70 Prozent der Bevölkerung erwartet<br />
von ihr „nur Schlimmes“. Da wird’s wohl<br />
Zeit, dass auch die Politik ihren Blick endlich<br />
schärft.<br />
■<br />
zm 93, Nr. <strong>17</strong>, 1. 9. 2003, (2079)