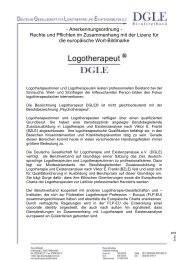Heft 18 /2010 - Deutsche Gesellschaft für Logotherapie und ...
Heft 18 /2010 - Deutsche Gesellschaft für Logotherapie und ...
Heft 18 /2010 - Deutsche Gesellschaft für Logotherapie und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sinn <strong>und</strong> Sein<br />
überhaupt kein Wert, sondern ein Maßstab <strong>für</strong> Werte <strong>und</strong> Wertertrag. Werte<br />
darf <strong>und</strong> soll man unmittelbar anstreben, Glück hingegen nicht. Man soll es<br />
nicht einmal beim Namen nennen, so Hermann Hesse in einem Gedicht. Was<br />
das konkret bedeutet, erfahren manche Ehepaare: Sie zerstören ihr gemeinsames<br />
Glück, indem sie allzu fest darauf fixiert sind. Glück, das wir direkt<br />
packen wollen, entschwindet. „Glücksstreben“, auch wenn es nach der amerikanischen<br />
Unabhängigkeitserklärung sogar als eine Art Gr<strong>und</strong>recht gilt<br />
(„pursuit of happiness“), sollte man in Anführungszeichen setzen. Es ist sozusagen<br />
ein Streben mit schrägem Blick: unmittelbar auf bestimmte Voraussetzungen<br />
gerichtet, das Glück selbst nur im Augenwinkel.<br />
Dementsprechend kann die Philosophie keine hinreichenden Bedingungen<br />
<strong>für</strong> Glück benennen. Die notwendigen Bedingungen allerdings sind ihr Feld.<br />
Glück hat klarerweise mit den Werten zu tun; es ist geradezu der Anzeiger<br />
<strong>für</strong> die Erfüllung unserer Wertvorstellungen. Auch unter diesem Blickwinkel<br />
lautet daher die Frage: Wo kommen die Werte her? Sie wurde bereits gestellt<br />
<strong>und</strong> ist jetzt in zwei Richtungen zu vertiefen: Wo kommen die Werte<br />
tatsächlich her; wie bildet sie der Mensch? Und: Wo kommen die „richtigen“<br />
Werte her; welche philosophischen Vorgaben gelten da<strong>für</strong>?<br />
Bevor wir diesen Fragen in den beiden nächsten Abschnitten nachgehen,<br />
ist ein Einschub fällig. Dem bisher Gesagten sollen zur Verdeutlichung zwei<br />
bekannte Gegenpositionen gegenübergestellt werden. Zunächst die Pflichtethik:<br />
Man unterscheidet bekanntlich Wertethik <strong>und</strong> Pflichtethik. Letztere wurde<br />
besonders pointiert von Kant vertreten: „das Sittengesetz in mir“. Dass ihr<br />
nicht zuzustimmen ist, dürfte klar geworden sein. Natürlich stehen neben<br />
den Werten auch Pflichten – als deren Dienerinnen, um sie im persönlichen<br />
Leben <strong>und</strong> zwischen den Menschen durchzusetzen. Vor den Pflichten rangieren<br />
die Werte; vor dem „Sollen“ rangiert das „Wollen“ – ohne Wollen kein<br />
Sollen. Wer die Dinge anders herum sieht, schneidet dem Sinn die Wurzeln<br />
ab. Daraus folgt meist eine moralisierende Ethik <strong>und</strong> eine dürre, nicht wärmende<br />
Tugend. „Sie will uns“, so Wilhelm Busch, „nicht immer passen. Im<br />
Ganzen lässt sie etwas kalt. Und dass man eine unterlassen, vergisst man<br />
bald“.<br />
Bei der zweiten Gegenposition ist die Ablehnung kühn, weil es sich nahezu<br />
um eine heilige Kuh der neueren Philosophie handelt. Aber wir müssen<br />
sie schlachten. Es ist das Dogma vom „naturalistischen Fehlschluss“. Danach<br />
darf das Sollen (<strong>und</strong> der Sinn) nicht aus dem Sein abgeleitet werden. Das<br />
Verbot geht auf David Hume <strong>und</strong> die Beobachtung zurück, dass aus einer<br />
Menge von Aussagesätzen kein Sollenssatz logisch abgeleitet werden kann,<br />
wenn die Ausgangsmenge nicht ebenfalls mindestens einen Sollenssatz ent-<br />
19