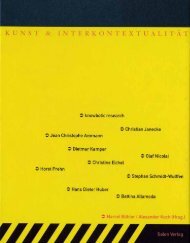PDF (2,8 MB) - kunst verlassen
PDF (2,8 MB) - kunst verlassen
PDF (2,8 MB) - kunst verlassen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
254<br />
Anmerkungen Christian Janecke<br />
einbar ist. Sennett 52 analysiert eine Gesellschaft, die seit dem<br />
18. Jahrhundert auf dem besten Wege ist, Schein und Tand auszumerzen,<br />
distanz- und kulturschaffende Formen der Darstellung<br />
als zeremoniellen Zierat zu entsorgen, um sich der „Tyrannei der<br />
Initimität“ zu beugen. Er versteht darunter einen Zustand der<br />
Gesellschaft, in dem der Einzelne sein darstellerisches Potential<br />
dem fragwürdigen Ideal eines: „Sei wie du bist“ zum Opfer<br />
gebracht, in dem die Gesellschaft Urbanität und Öffentlichkeit<br />
preisgegeben hat an die triste Alternative behelligenden Seelenmülls<br />
und kollektiver Darstellungs- und damit Sprachlosigkeit.<br />
Flankieren ließe sich Sennetts Diagnose durch die einschlägige<br />
Untersuchung Jonas A. Barishs 53 über „The Antitheatrical<br />
Prejudice“, in welcher der Autor in historischer Folge Stationen<br />
der Theaterfeindlichkeit bei Banausen und bei anerkannten Philosophen,<br />
schließlich sogar beim Theater selbst rekapituliert,<br />
welches Antitheatralität gleichsam internalisiert und beispielsweise<br />
zu Shakespeares Zeiten Schurken mit Vorliebe als chamäleontische<br />
Gestalten auf die Bühne treten läßt.<br />
Die von Barish und Sennett analysierte Exstirpierung theatraler<br />
Elemente des Alltags – unbelassen kompensatorischer Spektakel<br />
in der Massenunterhaltung respektive definierter Terrains in<br />
der Kunst – kritisiert durchaus kulturpessimistisch die Verengung<br />
auf ein Ideal der ‚ehrlichen Haut‘, das sich im Leben wie in der<br />
Kunst etwas darauf zugute hält, daß etwas ganz als das erscheine,<br />
was es ist. Auf diesem Ideal basiert uneingestandenermaßen auch<br />
diejenige Würdigung der Service-Kunst, der es vor allem um den<br />
Goodwill der Künstler, ihr ehrliches Bemühen geht, „wirklich“<br />
Los Angeles 1981. Helmar Schramm untersucht Barishs Problematik<br />
am Beispiel antitheatraler Selbstdisziplinierung des Theaters – ablesbar<br />
am veränderten Gebrauch der Theater-Metapher, der Rhetorik, des<br />
vom Theater verinnerlichten Bildungsauftrages, sogar des Theaterbaus,<br />
etwa wenn Friedrich Theodor Vischer im Zuge ästhetischen Autonomiedenkens<br />
fordert: „Das moderne Theater ist wesentlich Innenbau“.<br />
Vgl. Helmar Schramm: „Theatralität und Öffentlichkeit. Vorstudien zur<br />
Begriffsgeschichte von ‚Theater‘“, In: „Ästhetische Grundbegriffe. Studien<br />
zu einem historischen Wörterbuch“, hg. v. Karlheinz Barck u. a.,<br />
Berlin 1990, S. 202 – 242, zit. S. 230.<br />
54 Theodor W. Adorno: „Goldprobe“, in ders.: „Minima Moralia“,<br />
Ges. Schiften Bd. 4, Frankfurt a. M. 1980, S. 171 – 175, zit. S. 174 u.