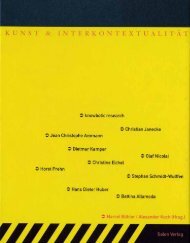PDF (2,8 MB) - kunst verlassen
PDF (2,8 MB) - kunst verlassen
PDF (2,8 MB) - kunst verlassen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
258<br />
Anmerkungen Christian Janecke<br />
ihn Andreas Kotte entwickelt hat, in Anschlag bringen: Demzufolge<br />
wäre die alte Als-ob-These von Theater 58 (die Kotte zufolge<br />
nicht mehr als eine Affinität zwischen Theater und Leben ausdrücken<br />
könne) zurückzustellen hinter die „Spezifik des theatralen<br />
Vorgangs als konkret historisch hervorgehobenes und zugleich<br />
konsequenzvermindertes interaktives Handeln“. „Der Akrobat<br />
auf dem Seil über dem Marktplatz handelte dann möglicherweise<br />
ebenso theatral wie ein Schauspieler als Hamlet, es käme auf<br />
die Beschreibung der Hervorhebungsmomente und den Grad<br />
der Konsequenzverminderung an“. 59 Vom „Spielerischen“, das<br />
ebenfalls als konsequenzvermindert und hervorgehoben begriffen<br />
werden kann, unterscheidet sich dieser Begriff von „Theatralität“<br />
nur in Nuancen, nämlich durch eine eher ostentative Tendenz,<br />
an deren Stelle im bloß Spielerischen eine integrative Tendenz<br />
steht. Was aber, wenn nicht Konsequenzverminderung (in bezug<br />
auf Praxisrelevanz) und Hervorhebung (in bezug auf das im Kunstkontext<br />
strategisch plazierte Ereignis) in ostentativer Färbung<br />
charakterisiert treffender die Schöpfungen der Service-Kunst? In<br />
dieser rekonstituieren sich also nicht bloß theatrale Formen im<br />
konventionelleren Sinne – etwa wenn die Künstler selbst Rollen<br />
übernehmen und inmitten ihrer Kulissen mimen müssen – sondern<br />
darüber hinaus auch theatrale Formen im Sinne Kottes, näm-<br />
munikation im und außerhalb des Theaters. (S. 7 f.). In: „Triadische<br />
Kollusion. Über die Beziehungen zwischen Autor, Schauspieler und<br />
Zuschauer im Theater“, (S. 97 – 111), führt Lazarowicz sein vom ABC-<br />
Modell (A spielt B, während C es sich anschaut) geprägtes Theaterverständnis<br />
nochmal aus, um es gegen extratheatrale Kommunikationsformen<br />
abzugrenzen. Vgl. Klaus Lazarowicz: „Gespielte Welt. Eine<br />
Einführung in die Theaterwissenschaft“, Frankfurt a. M./Berlin/Bern/<br />
York/Paris/Wien 1997.<br />
59 Andreas Kotte: „Simulation als Problem der Theatertheorie“, In<br />
„Forum Modernes Theater“, Heft 1/1996 (Bd. 11.), S. 33 – 44, bes.<br />
Abschn. 3 u. 4. Die Beziehungen zum Spiel und zum Fest bzw. zur Feier<br />
bei Andreas Kotte: „Die Welt ist kein Theater. Zur Spezifik des Festes<br />
und des theatralen Handelns“, in: „Weimarer Beiträge. Zeitschrift für<br />
Literaturwissenschaft, Ästhetik und Kulturtheorie“, 34. Jg., 1988/5, S.<br />
781 – 795.<br />
60 Andreas Spiegl: „Das Ex-ject oder das Subjekt als Gast bei sich<br />
selbst“, In: „Surfing Sytems“, S. 21 – 31, zit. S. 25. Spiegl bildet den