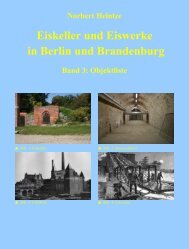Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Eishäuser vorhanden, so zum Beispiel im früheren<br />
Zentral-Militärhospital <strong>in</strong> Tempelhof (heutiges<br />
Vivantes Wenckebach-Kl<strong>in</strong>ikum) oder auch im<br />
Krankenhaus Friedrichsfelde.<br />
Gegen Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts wurden Eishäuser<br />
serienmäßig hergestellt <strong>und</strong> als Katalogware<br />
angeboten, wie zum Beispiel die „oberirdischen<br />
<strong>Eiskeller</strong> amerikanischen Systems aus Holz <strong>und</strong><br />
Haspelmoorer Isolimulle hergestellt von Wilhelm<br />
Lesti, Baugeschäft <strong>in</strong> Thalkirchen bei München“ aus<br />
dem Jahr 1910. Angeboten wurden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Katalog neun verschiedene Varianten. Gleichzeitig<br />
wird betont, dass die Gebäude <strong>in</strong> jeder gewünschten<br />
Form <strong>und</strong> Größe je nach Bedarf ausgeführt werden<br />
könnten. Von den Eishäusern aus Holz ist ke<strong>in</strong><br />
Exemplar mehr erhalten. Ihre Verbreitung ist<br />
heutzutage weitgehend unbekannt. Typische<br />
Eishäuser hatten e<strong>in</strong>e Gr<strong>und</strong>fläche von fünf Meter<br />
mal fünf Meter <strong>und</strong> das Eis wurde bis fünf Meter<br />
hoch gestapelt. Dies ergab e<strong>in</strong> Volumen von 125<br />
Kubikmeter. Die Eishäuser hatten e<strong>in</strong>e doppelte<br />
Holzwand mit e<strong>in</strong>em m<strong>in</strong>destens 40 Zentimeter<br />
breiten Zwischenraum, der mit Holzwolle, Schlacke<br />
oder Torf gefüllt wurde. Der Dachboden war aus<br />
Gewichtsgründen häufig mit Stroh isoliert.<br />
Eishäuser aus Ste<strong>in</strong> werden <strong>in</strong> der Literatur erst ab<br />
den 1870er Jahren aufgeführt. Obwohl ihr Bau<br />
wesentlich teurer war, hatten sie gegenüber den<br />
Holzkonstruktionen neben der längeren Haltbarkeit<br />
e<strong>in</strong>en erheblichen Vorteil, weil <strong>in</strong>nerhalb<br />
geschlossener Baugebiete die Errichtung größerer<br />
Holzhäuser wegen der Feuergefahr bedenklich war.<br />
Die Isolierung erfolgte im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert durch<br />
Hohlmauern, <strong>in</strong> denen nach Möglichkeit zwei bis<br />
drei Hohlräume e<strong>in</strong>gebaut waren. Ab der<br />
Jahrh<strong>und</strong>ertwende wurden Korkste<strong>in</strong> <strong>und</strong> Kieselgur<br />
als neuartiger Isolierstoff e<strong>in</strong>gesetzt. Die Eishäuser<br />
enthielten teilweise Kühlräume für Lebensmittel.<br />
Dabei war der Eisraum vom Volumen bis zu<br />
viermal so groß wie der Kühlraum <strong>und</strong> deutlich<br />
höher. Dadurch sollte e<strong>in</strong>e gute Belüftung erzielt<br />
werden, da die kalte Luft nach unten sank <strong>und</strong> die<br />
erwärmte Luft aus dem Lagerraum durch<br />
Abluftschächte <strong>in</strong> der Decke verdrängen konnte.<br />
Größere Eishäuser stellten neue statische<br />
Anforderungen an die Bauweise der Mauern. Das<br />
Eis übt auf den Boden e<strong>in</strong>en erheblichen Druck aus.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Eishöhe von zehn Meter lasten fast acht<br />
Tonnen Gewicht auf jeden Quadratmeter<br />
Bodenfläche! Dazu kommt auch e<strong>in</strong>e mögliche<br />
Belastung der Seitenwände, da das Eis auch hier<br />
e<strong>in</strong>e Kraft ausüben kann, wenn es sich während des<br />
Schmelzvorganges verschiebt. Das Zentralblatt der<br />
Bauverwaltung berichtete 1899 über e<strong>in</strong>e derartige<br />
Beschädigung e<strong>in</strong>es Eisspeichers der Oranienburger<br />
<strong>Eiswerke</strong> am Lehnitzsee. Dabei ist die fast zehn<br />
Meter hohe Seitenwand des Eishauses auf halber<br />
Höhe gerissen <strong>und</strong> wurde um etwa 80 Zentimeter<br />
nach außen gedrückt. Es bestand akute<br />
E<strong>in</strong>sturzgefahr. E<strong>in</strong>e Sonderform waren r<strong>und</strong>e<br />
Eishäuser. Sie hatten bessere Isoliereigenschaften,<br />
da hier e<strong>in</strong>e ger<strong>in</strong>gere Oberfläche vorhanden war.<br />
Nachteilig war die r<strong>und</strong>e Form allerd<strong>in</strong>gs dadurch,<br />
dass sie nicht <strong>in</strong> geschlossener Bauweise möglich<br />
war, sondern freistehend errichtet werden musste.<br />
Mehrere Berl<strong>in</strong>er Krankenhäuser, die zum Ende des<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>erts <strong>in</strong> parkähnlichen Gr<strong>und</strong>stücken<br />
errichtet wurden, hatten hierfür ausreichend Platz.<br />
Erhalten s<strong>in</strong>d die Eishäuser <strong>in</strong> der heutigen Karl-<br />
Bonhoeffer-Nervenkl<strong>in</strong>ik, im Kl<strong>in</strong>kum Buch <strong>und</strong> im<br />
Krankenhaus König<strong>in</strong> Elisabeth Herzberge<br />
Die hygienischen Zustände <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> wurden mit<br />
der beg<strong>in</strong>nenden Industrialisierung katastrophal. Ab<br />
der zweiten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts stieg die<br />
E<strong>in</strong>wohnerzahl <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> rasant an. Der epidemieartige<br />
Ausbruch von Krankheiten wie Typhus <strong>und</strong><br />
Cholera war zu befürchten. Das größte Problem war<br />
die Versorgung mit sauberem Tr<strong>in</strong>kwasser. Bis zur<br />
Errichtung der Wasserwerke diente ungefiltertes<br />
Fluss- oder Gr<strong>und</strong>wasser als Tr<strong>in</strong>kwasser. Durch die<br />
ungewollte Versickerung der Abwässer <strong>in</strong> den<br />
Boden <strong>und</strong> das E<strong>in</strong>leiten von ungeklärtem Abwasser<br />
<strong>in</strong> die Flüsse wurde die Wasserqualität erheblich<br />
bee<strong>in</strong>trächtigt. 1853 eröffnete die private „Berl<strong>in</strong><br />
Waterworks Company“ das erste Berl<strong>in</strong>er<br />
Wasserwerk. Durch den Ausbau der Wasserversorgung<br />
nahm selbstverständlich auch die<br />
Mengen des Abwassers erheblich zu. Dies stellte e<strong>in</strong><br />
weiteres großes Problem dar: Die Fäkalien der<br />
Berl<strong>in</strong>er Bevölkerung wurden <strong>in</strong> Gruben gesammelt<br />
oder flossen über offene R<strong>in</strong>nste<strong>in</strong>e zum<br />
nächstliegenden Gewässer ungeklärt ab. Auf dem<br />
selben Weg „entsorgten“ Gewerbebetriebe andere<br />
flüssige Abfälle, wie das Blut aus unzähligen<br />
kle<strong>in</strong>en Hausschlachtungen.<br />
8