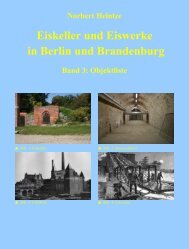Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 1 <strong>Eiskeller</strong> <strong>und</strong> Eishäuser<br />
Bereits zu Beg<strong>in</strong>n des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts gab es<br />
Fachliteratur, die die baulichen Anforderungen an<br />
e<strong>in</strong>en <strong>Eiskeller</strong> beschrieb. Unter „<strong>Eiskeller</strong>“<br />
verstand man früher nicht nur e<strong>in</strong> Bauwerk, das sich<br />
vollständig <strong>in</strong> der Erde befand <strong>und</strong> damit dem<br />
heutigen Begriff „Keller“ entspricht. Auch<br />
oberirdische Eishäuser wurden häufig als <strong>Eiskeller</strong><br />
bezeichnet. Die <strong>Eiskeller</strong> lassen sich <strong>in</strong> der Theorie<br />
grob <strong>in</strong> sechs Bauarten unterteilen:<br />
− Eisgrube (auch Eiskuhle genannt),<br />
− Eismiete <strong>und</strong> Eishaufen,<br />
− <strong>Eiskeller</strong> (unterirdisch <strong>und</strong> übererdet),<br />
− Eishaus aus Holz,<br />
− Eishaus aus Ste<strong>in</strong> <strong>und</strong><br />
− Spezialformen, zum Beispiel für Markthallen,<br />
Molkereibetriebe oder Leichenschauhäuser.<br />
Die Begriffe wurden von den verschiedenen<br />
Autoren nicht immer e<strong>in</strong>heitlich genutzt, was bei<br />
e<strong>in</strong>er 300 Jahre umfassenden Bibliografie nicht<br />
verw<strong>und</strong>erlich ist.<br />
Die Eisgrube – früher teilweise auch Eiskuhle<br />
genannt – ist ansche<strong>in</strong>end die älteste Bauform, die<br />
bereits 1712 <strong>in</strong> dem Büchle<strong>in</strong> „Eigentliche <strong>und</strong><br />
gründliche Nachricht von denen Eiß-Gruben“<br />
beschrieben wurde. In den Boden wurde e<strong>in</strong>e Grube<br />
mit etwa vier Meter Durchmesser gegraben, die sich<br />
häufig nach unten verjüngt. Die Seitenwände der<br />
Grube bestanden aus Feldste<strong>in</strong>en, Ziegelste<strong>in</strong>en<br />
oder aus Holz. Der untere Bereich der Grube wurde<br />
mit grobem Kies aufgefüllt, damit das<br />
Schmelzwasser sich dort sammeln <strong>und</strong> ablaufen<br />
konnte. Auf den Kies wurde e<strong>in</strong>e Lage mit Brettern<br />
gelegt, auf der das Eis gestapelt wurde. Zur<br />
Isolierung gegen die Erdwärme wurde Stroh<br />
verwendet, das sich zwischen dem Eis <strong>und</strong> der<br />
Außenwand befand. Der Aufbau bestand aus e<strong>in</strong>em<br />
kle<strong>in</strong>em Strohdach oder e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>em<br />
Holzhäuschen.<br />
Die Eismiete war e<strong>in</strong>e preiswerte Form der<br />
Eislagerung, da sie nur aus e<strong>in</strong>em Holzgestell<br />
bestand, das mit Stroh oder Rohr bedeckt war. Auf<br />
e<strong>in</strong>e tiefe Grube wurde hierbei völlig verzichtet. Im<br />
Boden wurde e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Kuhle ausgehoben, die mit<br />
Kieselste<strong>in</strong>en ausgelegt war, um das Schmelzwasser<br />
abzuleiten. Hierüber befand sich e<strong>in</strong> zeltartiges<br />
Holzgestell, das mit Stroh oder Rohr abgedeckt war.<br />
Die E<strong>in</strong>gangsschleuse lag Richtung Norden <strong>und</strong><br />
besaß möglichst zwei Türen.<br />
Der Eishaufen war e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fachere Variante der<br />
Eismiete. Hier wurde das Eis nur mit Torf, Erde<br />
oder Stroh abgedeckt. Es gab weder e<strong>in</strong> Holzgestell<br />
noch e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>gangstür. Die Höhe des Eishaufens<br />
sank mit der Verkle<strong>in</strong>erung des Eisvorrates.<br />
Dadurch musste die Abdeckung regelmäßig<br />
kontrolliert <strong>und</strong> ausgebessert werden. Die Eishaufen<br />
wurden auch teilweise als kostengünstige<br />
Ergänzung zu e<strong>in</strong>em vorhandenen <strong>Eiskeller</strong> genutzt.<br />
Der <strong>Eiskeller</strong> diente dann für den täglichen Bedarf,<br />
da er durch se<strong>in</strong>e Türen wesentlich e<strong>in</strong>facher<br />
zugänglich war. Wenn der Eisvorrat im <strong>Eiskeller</strong><br />
zur Neige g<strong>in</strong>g, wurde das Eis aus dem Eishaufen <strong>in</strong><br />
den <strong>Eiskeller</strong> gebracht, <strong>und</strong> der Eishaufen wurde am<br />
Ende vollständig abgeräumt.<br />
Vollständig unterirdische <strong>Eiskeller</strong> waren sehr<br />
aufwendig im Bau. Vor allem das Ausschachten der<br />
Baugrube <strong>und</strong> die stabilere Ausführung der Wände<br />
verteuerten den Bau erheblich. Für die richtige<br />
Dimensionierung der Wand- <strong>und</strong> Deckenstärken<br />
war bautechnisches Fachwissen erforderlich.<br />
Weiterh<strong>in</strong> musste das Bauwerk gut gegen<br />
aufsteigendes Gr<strong>und</strong>wasser oder versickerndes<br />
Oberflächenwasser abgedichtet se<strong>in</strong>. Der <strong>Eiskeller</strong><br />
sollte e<strong>in</strong>e kühle, geschützte <strong>und</strong> trockene Lage <strong>in</strong><br />
nicht zu weiter Entfernung von der Verbrauchsstelle<br />
erhalten. Der Eisbehälter musste gegen die<br />
Bodenwärme sowie die warme Außenluft isoliert<br />
werden. Es eigneten sich hierzu etwa e<strong>in</strong> Meter<br />
starke Ziegelmauern mit mehreren Luftschichten<br />
von acht Zentimeter Stärke. Die Luftschichten<br />
konnten auch mit Torfmull, porösen Schlacken oder<br />
Schlackenwolle ausgefüllt werden. Der Eisraum<br />
sollte möglichst <strong>in</strong> Zyl<strong>in</strong>derform oder besser <strong>in</strong><br />
Halbkugelform konstruiert werden, da hier e<strong>in</strong><br />
besseres Verhältnis von Oberfläche zum Inhalt<br />
bestand als bei e<strong>in</strong>em rechteckigen Raum.<br />
Gleichzeitig bot der r<strong>und</strong>e Gr<strong>und</strong>riss gegenüber dem<br />
seitlichen Erddruck e<strong>in</strong>en besseren Widerstand. Der<br />
E<strong>in</strong>gang sollte nach Norden liegen <strong>und</strong> möglichst<br />
kle<strong>in</strong> se<strong>in</strong>, damit beim Betreten wenig Wärme <strong>in</strong> das<br />
Bauwerk e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gen konnte. Der Zugang erfolgte<br />
über e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>gangsschleuse mit zwei oder besser<br />
drei h<strong>in</strong>tere<strong>in</strong>ander liegenden dicht schließenden<br />
Türen. Die Südseite des <strong>Eiskeller</strong>s musste vor<br />
4