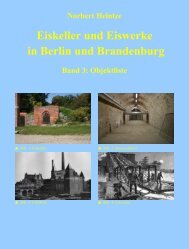Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Den besten Überblick über die <strong>Eiswerke</strong> <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong><br />
erhält man aus Berl<strong>in</strong>er Adressbüchern ab 1865.<br />
Dort s<strong>in</strong>d unter dem Stichwort „<strong>Eiswerke</strong> u.<br />
Eisfabrik“ unzählige Standorte nachgewiesen,<br />
außerdem h<strong>und</strong>erte von Eishändlern, die mit ihren<br />
Eiswagen <strong>und</strong> Eismännern das Eis zu den K<strong>und</strong>en<br />
transportierten. Viele <strong>Eiswerke</strong> lassen sich anhand<br />
der Eisschuppen <strong>und</strong> Eisteiche sehr gut <strong>in</strong> den<br />
damaligen Stadtplänen <strong>und</strong> später noch vere<strong>in</strong>zelt <strong>in</strong><br />
den Luftbildern aus den 1920er <strong>und</strong> 1930er Jahren<br />
erkennen. Die <strong>Eiswerke</strong> konzentrierten sich dabei <strong>in</strong><br />
Rummelsburg, Neukölln <strong>und</strong> Re<strong>in</strong>ickendorf.<br />
Der Vorgänger der Norddeutschen <strong>Eiswerke</strong><br />
wurde Mitte der 1860er Jahre von Carl Bolle<br />
(1832–1910) gegründet, dem späteren Besitzer der<br />
Meierei C. Bolle. Der erste E<strong>in</strong>trag im Adressbuch<br />
von 1868 nennt: „Bolle, Lützower Ufer 20“. Später<br />
wurde e<strong>in</strong> Eiswerk am nordwestlichen Ende des<br />
Rummelsburger Sees eröffnet. Die Firma handelte<br />
mit „Roheis, Eissp<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Seefischen“, wie aus<br />
e<strong>in</strong>er Annonce <strong>in</strong> der Berl<strong>in</strong>er Gerichts-Zeitung aus<br />
dem Jahr 1870 hervorgeht. 1872 erfolgte die<br />
Umwandlung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Aktiengesellschaft. Ende der<br />
1870er Jahre wurden <strong>in</strong> den bestehenden <strong>Eiswerke</strong>n<br />
zusätzlich kle<strong>in</strong>e Kunsteisfabriken errichtet. 1890<br />
erfolgte der Ankauf der 1873 gegründeten Moabiter<br />
<strong>Eiswerke</strong> am Plötzensee e<strong>in</strong>schließlich e<strong>in</strong>es<br />
Gr<strong>und</strong>stückes am Heiligensee. Vorbesitzer dieser<br />
<strong>Eiswerke</strong> war R. Ahrens, dem die Aktienbrauerei-<br />
Gesellschaft Moabit gehörte. Das Handbuch der<br />
deutschen Aktiengesellschaften von 1896/97 nennt<br />
<strong>Eiswerke</strong> <strong>in</strong> Rummelsburg, Köpenick, Plötzensee,<br />
Tegelort <strong>und</strong> Hannover. Zusätzlich gab es <strong>in</strong><br />
Rummelsburg <strong>und</strong> Plötzensee Kühlhäuser <strong>und</strong><br />
kle<strong>in</strong>e Kunsteisfabriken. E<strong>in</strong> Jahr zuvor wurden die<br />
ersten Kühlhäuser <strong>in</strong> der Köpenicker Straße <strong>in</strong><br />
Berl<strong>in</strong>-Mitte errichtet. Für e<strong>in</strong>ige Jahre wurde ab<br />
1887 e<strong>in</strong> Brennstoffhandel aufgenommen. 1901<br />
erfolgte der Abriss der Schuppen <strong>in</strong> Tegelort. Die<br />
Eishäuser stellten mit ihrer Holzbauweise <strong>und</strong> der<br />
Füllung mit Sägespänen tatsächlich e<strong>in</strong>e immense<br />
Feuergefahr dar, denn sie brannten wie Z<strong>und</strong>er. Vor<br />
allem, wenn im Sommer das Holz <strong>und</strong> das<br />
Isoliermaterial knochentrocken waren. Durch<br />
umherwirbelnde glühende Sägespäne waren auch<br />
Nachbargebäude <strong>in</strong> Gefahr. 1876 brannten die<br />
<strong>Eiswerke</strong> <strong>in</strong> Rummelsburg ab, 1913 die <strong>Eiswerke</strong><br />
<strong>in</strong> Plötzensee <strong>und</strong> 1917 die bereits stillgelegten<br />
<strong>Eiswerke</strong> <strong>in</strong> Köpenick. Kurz danach wurde das<br />
Gr<strong>und</strong>stück <strong>in</strong> Köpenick verkauft, 1921 die<br />
Gr<strong>und</strong>stücke <strong>in</strong> Rummelsburg <strong>und</strong> Plötzensee.<br />
Damit wurde der Verkauf von Natureis e<strong>in</strong>gestellt<br />
<strong>und</strong> es blieb nur das Gr<strong>und</strong>stück <strong>in</strong> der Köpenicker<br />
Straße übrig, auf dem sich neben den Kühlhäusern<br />
e<strong>in</strong>e 1914 eröffnete Kunsteisfabrik befand. Beide<br />
wurde bis <strong>in</strong> die 1990er Jahre genutzt (Seite 38).<br />
Die Aeltesten Berl<strong>in</strong>er <strong>Eiswerke</strong> Louis Thater<br />
lagen <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Re<strong>in</strong>ickendorf nordwestlich des<br />
Schäfersees, an der Ecke Genfer Straße <strong>und</strong><br />
Thaterstraße. Die Gründung erfolgte nach eigenen<br />
Angaben 1840. Bereits im Adressbuch von 1832 ist<br />
C.G. Thater e<strong>in</strong>getragen als „Schlächter <strong>und</strong><br />
Victualienhdlr [Lebenbensmittelhändler], Müllerstraße<br />
175“. Unklar bleibt, ab wann der Eishandel<br />
tatsächlich aufgenommen wurde. Zu e<strong>in</strong>em<br />
unbekannten Zeitpunkt wurde zusätzlich e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e<br />
Kunsteisfabrik auf dem Gelände errichtet. Ebenfalls<br />
unbekannt ist das Ende der Natureiserzeugung <strong>und</strong><br />
das der Eisfabrik. Im Branchen-Fernsprechbuch von<br />
1950 ist Thater nicht aufgeführt. Auf der Fläche der<br />
ehemaligen Teiche s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den 1950er Jahren<br />
Kle<strong>in</strong>gärten angelegt. E<strong>in</strong>ige Schuppen waren<br />
m<strong>in</strong>destens bis Ende der 1960er Jahre noch<br />
vorhanden <strong>und</strong> wurden später abgerissen. Im Jahr<br />
2012 s<strong>in</strong>d nur noch das Gebäude der Eisfabrik<br />
(Abb.47) <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Außenmauer e<strong>in</strong>es Schuppens<br />
vorhanden.<br />
Die <strong>Eiswerke</strong> Mudrack lagen unmittelbar südlich<br />
der <strong>Eiswerke</strong> von Thater nordwestlich des Schäfersees,<br />
zwischen der Mudrackzeile <strong>und</strong> dem<br />
Marienbrunner Weg. Die Gründung erfolgte nach<br />
eigenen Angaben 1856. Die Natureiserzeugung<br />
wurde 1911 e<strong>in</strong>gestellt, da zu diesem Zeitpunkt<br />
etwas weiter östlich an der Stargardtstraße die neue<br />
Eisfabrik Hermann E. Mudrack mit Kühlhaus <strong>in</strong><br />
Betrieb g<strong>in</strong>g, die bis <strong>in</strong> die 1970er Jahre existierte<br />
(Seite 38).<br />
Die <strong>Eiswerke</strong> Carl Thater <strong>in</strong> Charlottenburg-Nord<br />
lagen zwischen Saatw<strong>in</strong>kler Damm <strong>und</strong><br />
Heckerdamm <strong>und</strong> gehörten zu den größten<br />
<strong>Eiswerke</strong>n der Stadt. Die Anlagen wurden immer<br />
wieder erweitert, 1890 wurden die benachbarten<br />
Polar-<strong>Eiswerke</strong> von Colberg übernommen. Am<br />
Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts hatte der Schuppen e<strong>in</strong>e<br />
26