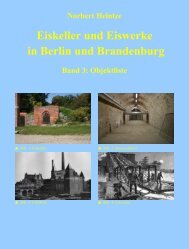Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Über den Neubau des oberirdischen Lagerkellers<br />
der Victoria-Brauerei <strong>in</strong> der Lützowstraße f<strong>in</strong>det<br />
sich im Zentralblatt der Bauverwaltung 1882<br />
folgende Beschreibung: „Die Brauerei bef<strong>in</strong>det sich<br />
<strong>in</strong> unmittelbarer Nähe des Landwehrkanals, daher<br />
konnte wegen des hohen Gr<strong>und</strong>wasserspiegels ke<strong>in</strong><br />
Keller angelegt werden. Zur Lagerung errichtete<br />
man daher e<strong>in</strong> Lagerhaus mit Obereiskeller.<br />
Zwischen dem Eisraum <strong>und</strong> dem Lagerraum befand<br />
sich e<strong>in</strong>e schmale „Kaltluftkammer“. Damit sollte<br />
erreicht werden, dass die kalte Luft sich<br />
gleichmäßig über alle Keller ausbreitet <strong>und</strong> dort<br />
über verschließbare Klappen <strong>in</strong> die Lagerkeller<br />
geleitet werden kann. Zum Befüllen des Eisraumes<br />
bef<strong>in</strong>det sich vor dem Kühlhaus e<strong>in</strong><br />
„Paternosterwerk“ das durch e<strong>in</strong> Lokomobil<br />
angetrieben wurde.“<br />
Mehrere deutsche Brauereien besaßen Eisgalgen,<br />
um direkt über ihren Lagerkellern Eis zu erzeugen.<br />
In frostigen Nächten wurde e<strong>in</strong> Holzgerüst mit<br />
Wasser berieselt. Dabei bildeten sich lange<br />
Eiszapfen, die von Arbeitern mit Äxten<br />
abgeschlagen wurden <strong>und</strong> anschließend direkt <strong>in</strong><br />
den darunter liegenden Keller geworfen wurden.<br />
Bei der Berechnung der Statik war aber zu<br />
beachten, dass das Gewicht des Eises mehrere<br />
Tonnen betragen konnte. Der E<strong>in</strong>satz bei e<strong>in</strong>er<br />
Brauerei <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> oder <strong>Brandenburg</strong> lässt sich<br />
bisher nicht nachweisen. Lediglich die<br />
Wochenschrift für Brauerei von 1901 berichtet über<br />
e<strong>in</strong> derartiges Gerüst, das <strong>in</strong> der Versuchs- <strong>und</strong><br />
Lehrbrauerei <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Wedd<strong>in</strong>g<br />
e<strong>in</strong>gesetzt wurde: „Der bei uns aufgestellte Apparat<br />
ist e<strong>in</strong> zweistöckiges Holzgerüst, 4,5 Meter Höhe,<br />
10 Meter lang, 4,5 Meter breit wird von acht<br />
Koser’schen Brausen gleichmäßig besprüht. Vor<br />
Sonnenstrahlen ist der Apparat bis Ende März<br />
vollständig geschützt, so dass man am Tage die<br />
Eiserzeugung nicht zu unterbrechen braucht. […]<br />
Bei Frost von –2 °R[éaumur, –2,5 °C] bis –4 °R.<br />
<strong>und</strong> mäßig starken Luftzug brauchten wir 4 ½ bis<br />
5 Tage […], bis sich so viele Eis gebildet hatte, daß<br />
zur E<strong>in</strong>heimsung geschritten werden mußte. Die<br />
Vorzüge dieser Natureis-Erzeugungsappararte<br />
erblicken wir dar<strong>in</strong>, dass 1. bei ger<strong>in</strong>ger Kälte<br />
früher Eis erhalten wird als von Teichen <strong>und</strong> Seen,<br />
2. der Fuhrlohn für das E<strong>in</strong>fahren des Eises <strong>in</strong> Wegfall<br />
kommt, vorausgesetzt, daß der Apparat neben<br />
oder über dem <strong>Eiskeller</strong> aufgestellt ist, 3. die<br />
Aufstellung e<strong>in</strong>es solchen Apparates <strong>in</strong> den meisten<br />
Fällen billiger ist, als die Anlage e<strong>in</strong>es eigenen<br />
Eissees.“<br />
E<strong>in</strong>e wichtige Voraussetzung für den<br />
wirtschaftlichen Betrieb der Brauereien war die<br />
Unabhängigkeit von der Eisbildung im W<strong>in</strong>ter. Für<br />
e<strong>in</strong>e Jahresproduktion von 2000 Kubikmeter Bier<br />
waren etwa 2500 Tonnen Eis notwendig. Der<br />
Eisvorrat sollte nach Möglichkeit für zwei Jahre<br />
ausreichend se<strong>in</strong>, damit auch nach e<strong>in</strong>em milden<br />
W<strong>in</strong>ter die Produktion weitergehen konnte.<br />
Andernfalls musste das Eis zu immensen Kosten<br />
aus anderen Regionen, teilweise sogar aus dem<br />
Ausland importiert werden. Hauptlieferant für<br />
Deutschland war damals Norwegen. Im viel zu<br />
warmen W<strong>in</strong>ter 1883/84 lag die Durchschnittstemperatur<br />
im Januar <strong>und</strong> Februar bei knapp<br />
fünf Grad Celsius! Die Abhängigkeit vom Natureis<br />
war e<strong>in</strong> ständiges Risiko, das e<strong>in</strong>e Brauerei <strong>in</strong> den<br />
Ru<strong>in</strong> treiben konnte. Erste Berichte über den E<strong>in</strong>satz<br />
von Kältemasch<strong>in</strong>en <strong>in</strong> der amerikanischen <strong>und</strong><br />
englischen Industrie stammen aus den 1860er<br />
Jahren, die <strong>in</strong> D<strong>in</strong>gler’s Polytechnischen Journal<br />
veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel 1864 über<br />
Kirk’s Eismasch<strong>in</strong>e. Diese wurde 1862 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Paraff<strong>in</strong>fabrik zu Bathgate aufgestellt. Sie war im<br />
Stande, die zur Gew<strong>in</strong>nung e<strong>in</strong>er halben Tonne Eis<br />
<strong>in</strong> 24 St<strong>und</strong>en erforderliche Kälte zu erzeugen. Erst<br />
im folgenden Jahrzehnt entwickelte der deutsche<br />
Ingenieur Carl von L<strong>in</strong>de (1842–1934) e<strong>in</strong>e für<br />
<strong>in</strong>dustriellen Dauere<strong>in</strong>satz geeigneten Kältemasch<strong>in</strong>e.<br />
Er gründete 1879 die Gesellschaft für<br />
L<strong>in</strong>des Eismasch<strong>in</strong>en Aktiengesellschaft. Nach<br />
relativ kurzer Zeit war das Unternehmen <strong>in</strong> Europa<br />
führend auf dem Gebiet der Kältetechnik.<br />
E<strong>in</strong>e der ersten Kältemasch<strong>in</strong>en <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Berl<strong>in</strong>er<br />
Brauerei wurde nach Angabe <strong>in</strong> dem 1877<br />
herausgegebenen Architekturband Berl<strong>in</strong> <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e<br />
Bauten <strong>in</strong> der damaligen Vere<strong>in</strong>sbrauerei Rixdorf<br />
aufgestellt, der späteren K<strong>in</strong>dl-Brauerei. Es soll sich<br />
dabei um e<strong>in</strong>e Kaltluftmasch<strong>in</strong>e vom System<br />
W<strong>in</strong>dhausen-Nehrlich gehandelt haben, die<br />
stündlich etwa 3000 Kubikmeter kalte Luft von<br />
– 45 °C liefern konnte. Zusätzlich zu dieser<br />
Kältemasch<strong>in</strong>e wurde e<strong>in</strong> <strong>Eiskeller</strong> für 3000 Tonnen<br />
Eis gebaut.<br />
18