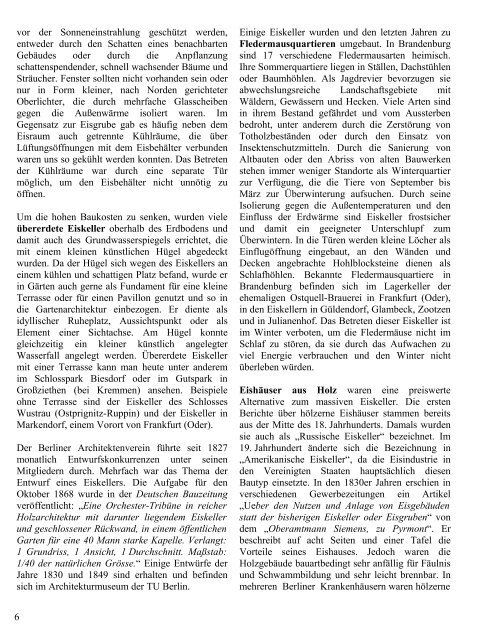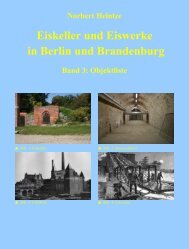Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
vor der Sonnene<strong>in</strong>strahlung geschützt werden,<br />
entweder durch den Schatten e<strong>in</strong>es benachbarten<br />
Gebäudes oder durch die Anpflanzung<br />
schattenspendender, schnell wachsender Bäume <strong>und</strong><br />
Sträucher. Fenster sollten nicht vorhanden se<strong>in</strong> oder<br />
nur <strong>in</strong> Form kle<strong>in</strong>er, nach Norden gerichteter<br />
Oberlichter, die durch mehrfache Glasscheiben<br />
gegen die Außenwärme isoliert waren. Im<br />
Gegensatz zur Eisgrube gab es häufig neben dem<br />
Eisraum auch getrennte Kühlräume, die über<br />
Lüftungsöffnungen mit dem Eisbehälter verb<strong>und</strong>en<br />
waren uns so gekühlt werden konnten. Das Betreten<br />
der Kühlräume war durch e<strong>in</strong>e separate Tür<br />
möglich, um den Eisbehälter nicht unnötig zu<br />
öffnen.<br />
Um die hohen Baukosten zu senken, wurden viele<br />
übererdete <strong>Eiskeller</strong> oberhalb des Erdbodens <strong>und</strong><br />
damit auch des Gr<strong>und</strong>wasserspiegels errichtet, die<br />
mit e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en künstlichen Hügel abgedeckt<br />
wurden. Da der Hügel sich wegen des <strong>Eiskeller</strong>s an<br />
e<strong>in</strong>em kühlen <strong>und</strong> schattigen Platz befand, wurde er<br />
<strong>in</strong> Gärten auch gerne als F<strong>und</strong>ament für e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e<br />
Terrasse oder für e<strong>in</strong>en Pavillon genutzt <strong>und</strong> so <strong>in</strong><br />
die Gartenarchitektur e<strong>in</strong>bezogen. Er diente als<br />
idyllischer Ruheplatz, Aussichtspunkt oder als<br />
Element e<strong>in</strong>er Sichtachse. Am Hügel konnte<br />
gleichzeitig e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>er künstlich angelegter<br />
Wasserfall angelegt werden. Übererdete <strong>Eiskeller</strong><br />
mit e<strong>in</strong>er Terrasse kann man heute unter anderem<br />
im Schlosspark Biesdorf oder im Gutspark <strong>in</strong><br />
Großziethen (bei Kremmen) ansehen. Beispiele<br />
ohne Terrasse s<strong>in</strong>d der <strong>Eiskeller</strong> des Schlosses<br />
Wustrau (Ostprignitz-Rupp<strong>in</strong>) <strong>und</strong> der <strong>Eiskeller</strong> <strong>in</strong><br />
Markendorf, e<strong>in</strong>em Vorort von Frankfurt (Oder).<br />
Der Berl<strong>in</strong>er Architektenvere<strong>in</strong> führte seit 1827<br />
monatlich Entwurfskonkurrenzen unter se<strong>in</strong>en<br />
Mitgliedern durch. Mehrfach war das Thema der<br />
Entwurf e<strong>in</strong>es <strong>Eiskeller</strong>s. Die Aufgabe für den<br />
Oktober 1868 wurde <strong>in</strong> der Deutschen Bauzeitung<br />
veröffentlicht: „E<strong>in</strong>e Orchester-Tribüne <strong>in</strong> reicher<br />
Holzarchitektur mit darunter liegendem <strong>Eiskeller</strong><br />
<strong>und</strong> geschlossener Rückwand, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em öffentlichen<br />
Garten für e<strong>in</strong>e 40 Mann starke Kapelle. Verlangt:<br />
1 Gr<strong>und</strong>riss, 1 Ansicht, 1 Durchschnitt. Maßstab:<br />
1/40 der natürlichen Grösse.“ E<strong>in</strong>ige Entwürfe der<br />
Jahre 1830 <strong>und</strong> 1849 s<strong>in</strong>d erhalten <strong>und</strong> bef<strong>in</strong>den<br />
sich im Architekturmuseum der TU Berl<strong>in</strong>.<br />
E<strong>in</strong>ige <strong>Eiskeller</strong> wurden <strong>und</strong> den letzten Jahren zu<br />
Fledermausquartieren umgebaut. In <strong>Brandenburg</strong><br />
s<strong>in</strong>d 17 verschiedene Fledermausarten heimisch.<br />
Ihre Sommerquartiere liegen <strong>in</strong> Ställen, Dachstühlen<br />
oder Baumhöhlen. Als Jagdrevier bevorzugen sie<br />
abwechslungsreiche Landschaftsgebiete mit<br />
Wäldern, Gewässern <strong>und</strong> Hecken. Viele Arten s<strong>in</strong>d<br />
<strong>in</strong> ihrem Bestand gefährdet <strong>und</strong> vom Aussterben<br />
bedroht, unter anderem durch die Zerstörung von<br />
Totholzbeständen oder durch den E<strong>in</strong>satz von<br />
Insektenschutzmitteln. Durch die Sanierung von<br />
Altbauten oder den Abriss von alten Bauwerken<br />
stehen immer weniger Standorte als W<strong>in</strong>terquartier<br />
zur Verfügung, die die Tiere von September bis<br />
März zur Überw<strong>in</strong>terung aufsuchen. Durch se<strong>in</strong>e<br />
Isolierung gegen die Außentemperaturen <strong>und</strong> den<br />
E<strong>in</strong>fluss der Erdwärme s<strong>in</strong>d <strong>Eiskeller</strong> frostsicher<br />
<strong>und</strong> damit e<strong>in</strong> geeigneter Unterschlupf zum<br />
Überw<strong>in</strong>tern. In die Türen werden kle<strong>in</strong>e Löcher als<br />
E<strong>in</strong>flugöffnung e<strong>in</strong>gebaut, an den Wänden <strong>und</strong><br />
Decken angebrachte Hohlblockste<strong>in</strong>e dienen als<br />
Schlafhöhlen. Bekannte Fledermausquartiere <strong>in</strong><br />
<strong>Brandenburg</strong> bef<strong>in</strong>den sich im Lagerkeller der<br />
ehemaligen Ostquell-Brauerei <strong>in</strong> Frankfurt (Oder),<br />
<strong>in</strong> den <strong>Eiskeller</strong>n <strong>in</strong> Güldendorf, Glambeck, Zootzen<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> Julianenhof. Das Betreten dieser <strong>Eiskeller</strong> ist<br />
im W<strong>in</strong>ter verboten, um die Fledermäuse nicht im<br />
Schlaf zu stören, da sie durch das Aufwachen zu<br />
viel Energie verbrauchen <strong>und</strong> den W<strong>in</strong>ter nicht<br />
überleben würden.<br />
Eishäuser aus Holz waren e<strong>in</strong>e preiswerte<br />
Alternative zum massiven <strong>Eiskeller</strong>. Die ersten<br />
Berichte über hölzerne Eishäuser stammen bereits<br />
aus der Mitte des 18. Jahrh<strong>und</strong>erts. Damals wurden<br />
sie auch als „Russische <strong>Eiskeller</strong>“ bezeichnet. Im<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>ert änderte sich die Bezeichnung <strong>in</strong><br />
„Amerikanische <strong>Eiskeller</strong>“, da die Eis<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong><br />
den Vere<strong>in</strong>igten Staaten hauptsächlich diesen<br />
Bautyp e<strong>in</strong>setzte. In den 1830er Jahren erschien <strong>in</strong><br />
verschiedenen Gewerbezeitungen e<strong>in</strong> Artikel<br />
„Ueber den Nutzen <strong>und</strong> Anlage von Eisgebäuden<br />
statt der bisherigen <strong>Eiskeller</strong> oder Eisgruben“ von<br />
dem „Oberamtmann Siemens, zu Pyrmont“. Er<br />
beschreibt auf acht Seiten <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er Tafel die<br />
Vorteile se<strong>in</strong>es Eishauses. Jedoch waren die<br />
Holzgebäude bauartbed<strong>in</strong>gt sehr anfällig für Fäulnis<br />
<strong>und</strong> Schwammbildung <strong>und</strong> sehr leicht brennbar. In<br />
mehreren Berl<strong>in</strong>er Krankenhäusern waren hölzerne<br />
6