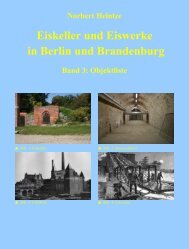Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In Molkereien spielte die Kühlung mit Eis bis zur<br />
Mitte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts e<strong>in</strong>e untergeordnete<br />
Rolle. Das Handbuch des gesammten landwirthschaftlichen<br />
Bauwesens berichtet 1853: „Das<br />
Molkenhaus muß e<strong>in</strong>e Milchkammer oder e<strong>in</strong>en<br />
Milchkeller, ferner Butterkeller, Käsestube <strong>und</strong><br />
Molkenküche enthalten. Die gewonnene Milch,<br />
welche sofort nach dem Melken aus dem Stalle<br />
entfernt wird, damit sie nicht den Geruch desselben<br />
annehme, wird zum Ausrahmen nach e<strong>in</strong>em<br />
besonderen, im Sommer kühlen, im W<strong>in</strong>ter warmen<br />
Lokale, der Milchkammer oder dem Milchkeller<br />
getragen. Im Sommer erkaltet die Milch sehr<br />
langsam, man kühlt daher, um die Temperatur der<br />
Milchkammer, welche erfahrungsgemäß 10 ºR bis<br />
12 ºR. [12,5 bis 15 ºC] nicht übersteigen darf, nicht<br />
ungebührlich zu erhöhen, die Milch durch<br />
E<strong>in</strong>stellen der verz<strong>in</strong>nten, kupfernen oder<br />
mess<strong>in</strong>genen Milchgefäße <strong>in</strong> kaltes Wasser ab.“<br />
Zum Ende des 19. Jahrh<strong>und</strong>ert stieg der Bedarf an<br />
Kühlleistung, spätestens mit der E<strong>in</strong>führung der<br />
Pasteurisierung nach 1900, da die Milch zunächst<br />
für wenige Sek<strong>und</strong>en auf über 70 ºC erhitzt <strong>und</strong><br />
anschließend möglichst schnell wieder gekühlt<br />
werden muss. Größere Molkereien konnten<br />
Kühlmasch<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>setzen, bei kle<strong>in</strong>eren Molkereien<br />
genügte anfangs noch Eiskühlung (Abb. 15 <strong>und</strong><br />
Abb. 112). Entscheidenden E<strong>in</strong>fluss auf die<br />
Entwicklung der Berl<strong>in</strong>er Molkereien hatte Carl<br />
Bolle. Er war e<strong>in</strong> vielseitiger Unternehmer <strong>und</strong><br />
zunächst im Adressbuch als Maurermeister<br />
aufgeführt. In den 1860er Jahren gründete er die<br />
Norddeutschen <strong>Eiswerke</strong>, die <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> Natureis,<br />
Eisschränke sowie anfangs auch Fische verkauften.<br />
1881 entstand die „Prov<strong>in</strong>cial-Meierei C. Bolle“,<br />
die sich später zur größten Berl<strong>in</strong>er Molkerei<br />
entwickelte. Bolle bezog die Milch teilweise aus<br />
dem Berl<strong>in</strong>er Umland <strong>und</strong> transportierte sie mit der<br />
Eisenbahn nach Berl<strong>in</strong>. Die Milch wurde mit<br />
Pferdegespannen, den so genannten Bollewagen, im<br />
gesamten Stadtgebiet ausgeliefert.<br />
In den Anatomischen Instituten der Universitäten<br />
wurden zur Ausbildung der Studenten menschliche<br />
Leichen <strong>und</strong> Tierkadaver benötigt, für die e<strong>in</strong>e<br />
geeignete Lagerung notwendig war. Das Handbuch<br />
der Architektur berichtet 1884: „Diese Räume<br />
liegen vortheilhaft im Sockelgeschoss im Anschluss<br />
an den Leichenkeller <strong>und</strong> dessen Nebenräume. Der<br />
Leichenkeller soll den grössten Theil des zur<br />
Verarbeitung <strong>in</strong> den Präparir-Sälen <strong>und</strong> zur<br />
Anfertigung von Sammlungs-Präparaten<br />
bestimmten Rohmaterials aufnehmen. Während der<br />
Zeit zwischen den Präparir-Uebungen werden auch<br />
die unfertigen Arbeiten der Praktikanten im<br />
Leichenkeller untergebracht. Die Aufgabe des<br />
Architekten besteht hiernach dar<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>en Raum zu<br />
schaffen, welcher der fortschreitenden Verwesung<br />
der Leichen möglichst wenig Vorschub leistet. In<br />
den meisten Fällen hat man sich damit begnügt,<br />
gewölbte Keller mit Luft-Isolirschicht <strong>in</strong> den bis<br />
zum Gewölbekämpfer mit Erde beschütteten<br />
Umfassungswänden anzulegen, deren wenige<br />
Fenster nach Norden gerichtet s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> mit<br />
hölzernen Läden verschlossen werden. Die Leichen<br />
werden auf Brettern r<strong>in</strong>gs an den Wänden direct auf<br />
den Ste<strong>in</strong>fussboden oder auf niedrigen Pritschen<br />
gelagert. Für gute Lüftung <strong>und</strong> grosse Re<strong>in</strong>lichkeit<br />
ist selbstverständlich zu sorgen.“ Zusätzliche<br />
<strong>Eiskeller</strong> konnten die Temperatur niedrig halten.<br />
Die Eiskühlung der Leichen war aber nicht ideal, da<br />
die dadurch bed<strong>in</strong>gte hohe Luftfeuchtigkeit <strong>in</strong> den<br />
Räumen e<strong>in</strong>e längere Lagerung unmöglich machte.<br />
Zudem war das Befüllen des <strong>Eiskeller</strong>s teuer, wenn<br />
die Gebäude mitten <strong>in</strong> der Stadt lagen <strong>und</strong> das Eis<br />
mit Fuhrwerken vom Eiswerk geholt werden<br />
musste. Daher stellte man die Konservierung auf<br />
chemische Mittel um, sofern es sich nicht um<br />
Beweismittel von Krim<strong>in</strong>alfällen aus der<br />
Gerichtsmediz<strong>in</strong> handelte.<br />
Im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert war die Erdbestattung <strong>in</strong><br />
Deutschland die übliche Bestattungsmethode. Für<br />
die Aufbewahrung der Särge bis zur Beerdigung<br />
gab es auf den Friedhöfen Leichenhallen, die zum<br />
Beispiel im Untergeschoss der Friedhofskapellen<br />
errichtet wurden. Normalerweise reichten hier die<br />
normalen Kellertemperaturen aus, da die Lagerzeiten<br />
der Säge bis zur Beerdigung relativ kurz<br />
waren. In der heute noch vorhandenen Kapelle des<br />
Friedhofes II der Georgen-Parochial-Geme<strong>in</strong>de <strong>in</strong><br />
Prenzlauer Berg wurden dagegen an der Stirnseite<br />
zwei <strong>Eiskeller</strong> e<strong>in</strong>gerichtet, die zusammen mit zwei<br />
Gängen für die kühle Luft die Leichenkammer von<br />
drei Seiten umgaben. Dieses Gebäude wurde <strong>in</strong> der<br />
Zeitschrift für Bauwesen 1870 ausführlich<br />
beschrieben.<br />
12