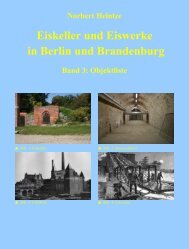Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Gesellschaft für Markt- <strong>und</strong> Kühlhallen<br />
nahm 1902 zwei neu erbaute Kühlhäuser am<br />
Gleisdreieck der U-Bahn <strong>in</strong> Betrieb. Die Anlagen<br />
befanden sich zwischen der Trebb<strong>in</strong>er <strong>und</strong> der<br />
Luckenwalder Straße <strong>und</strong> wurden später als Werk<br />
Südwest bezeichnet. Die beiden Kühlhäuser<br />
besaßen e<strong>in</strong>schließlich der Kellergeschosse je acht<br />
Stockwerke von drei Metern Höhe. Die vermietbare<br />
Bodenfläche der beiden Gebäude <strong>und</strong> der<br />
Hofunterkellerung betrug 9400 Quadratmeter. Im<br />
Kühlhaus I wurden bei der Eröffnung zwei<br />
Stockwerkhöhen für den Eiserzeugungsraum<br />
genutzt. Zwei Eisgeneratoren konnten täglich 100<br />
Tonnen Eis herzustellen. Der für e<strong>in</strong>en dritten<br />
Generator vorgesehene Raum wurde damals als<br />
Eismagaz<strong>in</strong> benutzt. Zusätzlich gab es noch e<strong>in</strong><br />
Masch<strong>in</strong>enhaus <strong>und</strong> e<strong>in</strong> Verwaltungsgebäude. In der<br />
Trebb<strong>in</strong>er Straße befand sich auf der südlichen<br />
Straßenseite e<strong>in</strong> weiteres Gebäude für Büros <strong>und</strong><br />
Pferdeställe, das heute vom Deutschen<br />
Technikmuseum Berl<strong>in</strong> als Haupte<strong>in</strong>gang genutzt<br />
wird. 1978 wurde der Kühlhausbetrieb e<strong>in</strong>gestellt<br />
<strong>und</strong> danach das Masch<strong>in</strong>enhaus sowie das Kühlhaus<br />
I abgerissen. Das lange Zeit leerstehende <strong>und</strong> unter<br />
Denkmalschutz stehende Kühlhaus II wird seit 2011<br />
saniert <strong>und</strong> zu e<strong>in</strong>em Ort für Kulturveranstaltungen<br />
umgebaut. E<strong>in</strong> weiteres Werk, Nordwest genannt,<br />
befand sich <strong>in</strong> der Scharnhorststraße 29 <strong>und</strong> gehörte<br />
zu DDR-Zeiten zum VEB Kühlbetrieb. Heute wird<br />
dieses denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr<br />
1912 nach umfassender Renovierung gewerblich<br />
<strong>und</strong> zu Wohnzwecken genutzt. Die Gesellschaft<br />
betrieb auch <strong>in</strong> Hamburg mehrere Kühlhäuser, die<br />
aber <strong>in</strong>zwischen alle abgerissen worden s<strong>in</strong>d. Noch<br />
heute betreibt die MUK AG als Rechtsnachfolger<br />
b<strong>und</strong>esweit Kühlhallen, so auch <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> <strong>in</strong> der<br />
Beusselstraße <strong>und</strong> Niemetzstraße.<br />
Die Eisfabrik des städtischen Elektrizitätswerkes<br />
Steglitz wurde um 1910 von der damals selbständigen<br />
Geme<strong>in</strong>de errichtet <strong>und</strong> an das ebenfalls<br />
geme<strong>in</strong>deeigene Elektrizitätswerk angeschlossen.<br />
Die Masch<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>es Elektrizitätswerkes müssen<br />
immer auf den Maximalbedarf ausgerichtet se<strong>in</strong>.<br />
Dieser steigt naturgemäß immer nach<br />
Sonnenuntergang <strong>und</strong> im W<strong>in</strong>ter an, wenn die<br />
elektrische Beleuchtung e<strong>in</strong>geschaltet wird.<br />
Dadurch ergaben sich tagsüber Zeiten, <strong>in</strong> denen die<br />
Anlage nicht ausgelastet wurde. E<strong>in</strong>e Eisfabrik<br />
wurde als s<strong>in</strong>nvolle Ergänzung betrachtet, da der<br />
höchste Eisverbrauch im Sommer stattfand. Die<br />
Eiserzeugung konnte während der Spitzenzeiten<br />
e<strong>in</strong>gestellt werden. Als besonders wirtschaftlich<br />
wurde e<strong>in</strong> 16-stündiger Betrieb der Eisfabrik<br />
angesehen. Die Leistung der Eisfabrik war auf 100<br />
Tonnen Kristalleis täglich (bei 20 St<strong>und</strong>en<br />
Betriebsdauer) ausgelegt;e<strong>in</strong>e Verdopplung der<br />
Leistung war baulich vorgesehen. Die Räume des<br />
<strong>Eiswerke</strong>s befanden sich unter der Straßenbahnhalle,<br />
die unmittelbar neben dem Elektrizitätswerk<br />
lag. Das Eiswerk bestand aus dem<br />
Masch<strong>in</strong>enraum für die Kältemasch<strong>in</strong>e, dem<br />
Eisgenerator-Raum <strong>und</strong> dem Eislager. Das Kondensat<br />
der Dampfturb<strong>in</strong>en vom Elektrizitätswerk diente<br />
zur Erzeugung des Klareises. Über die weitere<br />
Entwicklung dieser Eisfabrik nach dem Ersten<br />
Weltkrieg liegen ke<strong>in</strong>e Informationen vor.<br />
1911 wurde der Admiralspalast eröffnet, <strong>in</strong> dem<br />
sich e<strong>in</strong>e Eisbahn, Cafés, e<strong>in</strong> K<strong>in</strong>o sowie e<strong>in</strong><br />
Hallenbad befanden. Die Zeitschrift für die gesamte<br />
Kälte-Industrie berichte 1913: „Um die dem Betrieb<br />
der Eisbahn dienende Kältemasch<strong>in</strong>enanlage voll<br />
auszunutzen, ist dann weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Eisfabrik<br />
vorhanden, die imstande ist, 35.000 kg Eis <strong>in</strong><br />
24 Std. zu erzeugen. […] Die Kältemasch<strong>in</strong>en <strong>und</strong><br />
die Eisfabrik s<strong>in</strong>d im Keller untergebracht. […] Die<br />
Kältemasch<strong>in</strong>enanlage dient weiterh<strong>in</strong> zur Kühlung<br />
der weitverzweigten Wirtschaftskühlräume. Die<br />
Lieferung der gesamten Eisgeneratorenanlage<br />
wurde wiederum der Firma Escher, Wyß & Co<br />
übertragen.“<br />
Die Komb<strong>in</strong>ation e<strong>in</strong>es anderen Betriebes mit der<br />
Kälteerzeugung erhöhte die Wirtschaftlichkeit durch<br />
die gleichmäßige Auslastung der Dampfmasch<strong>in</strong>en.<br />
1926 erschien die Denkschrift über die Erbauung<br />
e<strong>in</strong>es Warmwasser-Hallenschwimmbades mit<br />
Kunsteisbahn im Anschluss an die Eisfabrik<br />
Hermann E. Mudrack [...] <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong>-Re<strong>in</strong>ickendorf.<br />
Zum Heizen des Badewassers sollte der Abdampf<br />
der Dampfmasch<strong>in</strong>en genutzt werden. E<strong>in</strong> anderer<br />
Vorschlag sah vor, bei der Ende 1920er Jahre<br />
erfolgten Zuschüttung des Luisenstädtischen Kanals<br />
e<strong>in</strong> Freibad im Engelbecken zu eröffnen <strong>und</strong> das<br />
Wasser durch die benachbarte Eisfabrik der<br />
Norddeutschen <strong>Eiswerke</strong> erwärmen zu lassen. Beide<br />
Vorhaben wurden nicht umgesetzt.<br />
36