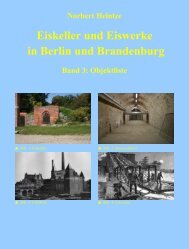Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Eiskeller und Eiswerke in Berlin und Brandenburg. Band 1 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kapitel 5: Lagerkeller<br />
Schon frühzeitig wurde der Erdboden mit se<strong>in</strong>er<br />
konstanten Temperatur als Lagerraum für<br />
empf<strong>in</strong>dliche Lebensmittel wie Obst <strong>und</strong> Gemüse<br />
genutzt. Sie mussten kühl aber frostfrei gelagert<br />
werden. Im Gegensatz zu den <strong>Eiskeller</strong>n, bei denen<br />
die Temperatur im Idealfall unter dem Gefrierpunkt<br />
lag, herrschen <strong>in</strong> Erdkellern <strong>in</strong> Deutschland etwa<br />
neun Grad Celsius. Neben Kellern für Obst <strong>und</strong><br />
Gemüse gab es auch Keller für Futterrüben oder<br />
leicht brennbare Flüssigkeiten, wie beispielsweise<br />
Petroleum. Im B<strong>und</strong>esland <strong>Brandenburg</strong> s<strong>in</strong>d noch<br />
viele dieser Keller auf alten Bauernhöfen oder<br />
Gutshöfen zu f<strong>in</strong>den. Sie werden aber <strong>in</strong> den<br />
meisten Fällen nicht mehr genutzt, s<strong>in</strong>d<br />
zweckentfremdet oder mit Gerümpel vollgestellt.<br />
E<strong>in</strong> häufig noch vorhandener Typ ist der<br />
unterirdische Keller, der sich im flachen Gelände<br />
bef<strong>in</strong>det. Er besitzt e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>es Zugangsbauwerk<br />
(Abb. 54), <strong>in</strong> dem e<strong>in</strong>e steile Treppe oder Leiter<br />
nach unten führt. Das Dach ist als Schrägdach<br />
ausgelegt. Der eigentliche Keller bef<strong>in</strong>det sich dann<br />
knapp unter dem Gelände, se<strong>in</strong> Boden liegt damit<br />
etwa zwei bis drei Meter unter der<br />
Geländeoberkante. Wichtig war auch e<strong>in</strong>e gute Be<strong>und</strong><br />
Entlüftung <strong>und</strong> der Schutz vor Schädl<strong>in</strong>gen wie<br />
Mäusen oder Ratten. Größere Keller aus dem<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>ert wurden häufig mit e<strong>in</strong>er Decke aus<br />
sogenannten Preußischen Kappen abgedeckt, sonst<br />
war die Kellerdecke bevorzugt als Tonnengewölbe<br />
konstruiert. E<strong>in</strong>en erheblichen Nachteil hatten diese<br />
Keller: Sie eigneten sich nicht für schwere oder<br />
sperrige Güter, da alles über die Kellertreppe<br />
h<strong>in</strong>unter getragen werden musste, sofern nicht e<strong>in</strong>e<br />
gesonderte Ladeluke vorhanden war.<br />
Wesentlich e<strong>in</strong>facher <strong>und</strong> preiswerter war der Bau<br />
der übererdeten Keller. Bei diesem Bautyp hat man<br />
sich darauf beschränkt, den Keller nur halb <strong>in</strong> den<br />
Boden e<strong>in</strong>zulassen. Dies war bei hohem Gr<strong>und</strong>wasserspiegel<br />
vorteilhaft. Nach dem Aushub der<br />
Grube wurde das Mauerwerk errichtet, <strong>und</strong> der<br />
Keller wurde mit dem Erdaushub abgedeckt. Als<br />
zusätzlichen Schutz vor Sonnene<strong>in</strong>strahlung konnte<br />
der Keller mit kle<strong>in</strong>en Büschen bepflanzt werden.<br />
Über e<strong>in</strong>e flache Rampe konnte man mit Hilfe e<strong>in</strong>er<br />
Schubkarre schwere Lasten wie gefüllte Fässer oder<br />
große Kisten e<strong>in</strong>lagern.<br />
Der We<strong>in</strong>anbau <strong>in</strong> <strong>Brandenburg</strong> ist weitgehend<br />
vergessen. Bereits seit dem 13. Jahrh<strong>und</strong>ert wurde<br />
<strong>in</strong> der Mark <strong>Brandenburg</strong> We<strong>in</strong>anbau betrieben,<br />
hauptsächlich durch Klöster <strong>und</strong> den Adel. Weil die<br />
besseren We<strong>in</strong>e aus südlicheren Regionen <strong>in</strong>folge<br />
hoher Transportkosten <strong>und</strong> Zollgebühren sehr teuer<br />
waren, begnügte man sich mit dem brandenburgischen<br />
We<strong>in</strong>. Spötter sagten ihm nach:<br />
„Märkischer Erde We<strong>in</strong>erträge gehen durch die<br />
Kehle wie e<strong>in</strong>e Säge“. Das Ende des märkischen<br />
We<strong>in</strong>baus vollzog sich im 18. <strong>und</strong> 19. Jahrh<strong>und</strong>ert,<br />
verursacht durch harte W<strong>in</strong>ter sowie später durch<br />
die Eisenbahnen, die die kostengünstige E<strong>in</strong>fuhr<br />
südlicher We<strong>in</strong>e ermöglichten. Der brandenburgische<br />
We<strong>in</strong>anbau verlagerte se<strong>in</strong>en Schwerpunkt<br />
von Kelterwe<strong>in</strong>trauben zu Speisewe<strong>in</strong>trauben.<br />
Aus den gleichen Gründen breiteten sich die<br />
Obstbäume <strong>in</strong> den We<strong>in</strong>bergen immer weiter aus,<br />
wie zum Beispiel die Kirschbäume <strong>in</strong> Werder. Die<br />
meisten der ehemaligen We<strong>in</strong>berge s<strong>in</strong>d jedoch<br />
verwildert oder wurden im Laufe der Zeit überbaut.<br />
Es soll <strong>in</strong> <strong>Brandenburg</strong> nach Angaben des<br />
brandenburgischen M<strong>in</strong>isteriums für Landwirtschaft<br />
400 bis 500 We<strong>in</strong>berge gegeben haben. Aber wo<br />
befanden sie sich? Vielfach hilft e<strong>in</strong> Blick <strong>in</strong> den<br />
Stadtplan. Viele Orts- <strong>und</strong> Straßennamen er<strong>in</strong>nern<br />
daran, wie „We<strong>in</strong>bergstraße“ <strong>in</strong> Potsdam, „We<strong>in</strong>bergsweg“<br />
<strong>in</strong> Altdöbern oder „W<strong>in</strong>zerhöhe“ <strong>in</strong><br />
Jüterbog.<br />
E<strong>in</strong>e Gesamtübersicht zu diesem Thema ist bisher<br />
nicht vorhanden. Es gibt immer nur vere<strong>in</strong>zelte<br />
H<strong>in</strong>weise auf den regionalen We<strong>in</strong>anbau, so zum<br />
Beispiel vom Landesumweltamt <strong>Brandenburg</strong> über<br />
den We<strong>in</strong>anbau <strong>in</strong> Teltow-Fläm<strong>in</strong>g: „Bis 1782<br />
wurden <strong>in</strong> Großbeuthen noch zehn Morgen<br />
We<strong>in</strong>berge bewirtschaftet. Mit der Ernte wurde<br />
überwiegend die Essigfabrik <strong>in</strong> Zossen beliefert.<br />
Von ‚vorzüglicher‘ Qualität soll der We<strong>in</strong> gewesen<br />
se<strong>in</strong>, den Mönche auf dem Dobbrikower We<strong>in</strong>berg<br />
anbauten. Auf dem Stückener We<strong>in</strong>berg, dem<br />
südlichsten Ausläufer der Saarm<strong>und</strong>er Moräne,<br />
wurde sogar 1801 noch We<strong>in</strong> angebaut. Die<br />
Besiedelung ehemaliger We<strong>in</strong>berge mit speziellen<br />
Pflanzen- <strong>und</strong> Tierarten ist auch heute noch für den<br />
Naturschutz <strong>in</strong>teressant. We<strong>in</strong>berge f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong><br />
fast allen Orten der Teltowplatte, weiter südlich vor<br />
allem nahe der Seen. Auch der Fläm<strong>in</strong>g-Anstieg bei<br />
Baruth wurde ehemals als We<strong>in</strong>berg genutzt.“<br />
42