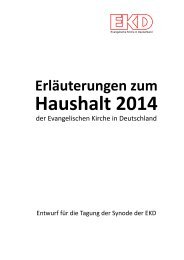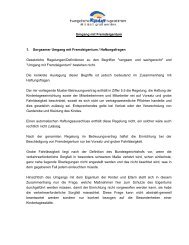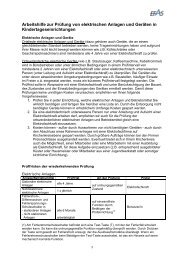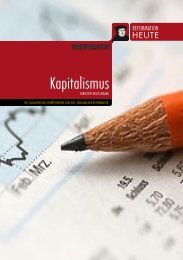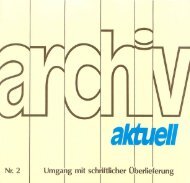Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
MACHT<br />
ALLTAGSGESCHICHTE N⁰4<br />
10<br />
<strong>Kirche</strong> und Völkerwelt,<br />
<strong>in</strong>: Bonhoeffer (DBW 13)<br />
1994: 298ff. (301).<br />
11<br />
Bonhoeffer (DBW 6)<br />
1992: 130.<br />
12<br />
Bonhoeffer (DBW 6)<br />
1992: 392ff.<br />
13<br />
Bonhoeffer (DBW 8)<br />
1998: 477, 511 u.ö.<br />
14<br />
Bonhoeffer (DBW 8)<br />
1998: 25.<br />
15<br />
Bonhoeffer (DBW 8)<br />
1998: 571.<br />
> fismus, aus dem Bonhoeffer auch persönlich<br />
Konsequenzen zog.<br />
Dazu gehörte ebenso der Versuch, die <strong>Kirche</strong><br />
zur Klarheit <strong>in</strong> den Bekenntnisfragen ihrer Zeit<br />
zu nötigen, <strong>in</strong>sbesondere auch <strong>in</strong> dem klaren Bekenntnis<br />
zu ihren Gliedern jüdischer Herkunft, e<strong>in</strong><br />
Schritt, der dann immer klarer zum Bekenntnis<br />
für das Lebensrecht aller Jüd<strong>in</strong>nen und Juden und<br />
zum Aufbegehren gegen Judenmord und Euthanasie<br />
führte, wie das „Schuldbekenntnis der <strong>Kirche</strong>“<br />
<strong>in</strong> Bonhoeffers „Ethik“ besonders klar zeigt. 11<br />
Zu den Konsequenzen aus der Begegnung<br />
mit der Bergpredigt gehörte ebenso der Versuch,<br />
die <strong>Kirche</strong> <strong>in</strong> Zeugnis und Gestalt zu stärken –<br />
und zwar dadurch, dass die jungen Pfarrer dafür<br />
ausgebildet und dazu befähigt wurden, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
glaubenswidrigen Welt den Glauben an Jesus<br />
Christus zu bezeugen. Das setzte, wie Bonhoeffer<br />
erkannte, nicht nur Festigkeit <strong>in</strong> der Lehre,<br />
sondern Verwurzelung <strong>in</strong> gelebter Frömmigkeit<br />
und Erfahrungen mit e<strong>in</strong>er überzeugenden Form<br />
„<br />
VERANTWORTUNG<br />
IST AUCH<br />
FÜRSORGE FÜR<br />
FREMDES LEBEN.<br />
“<br />
des geme<strong>in</strong>samen Lebens voraus.<br />
So entlegen F<strong>in</strong>kenwalde bei<br />
Stett<strong>in</strong>, der Ort von Bonhoeffers<br />
Predigersem<strong>in</strong>ar, vom politischen<br />
<strong>Macht</strong>zentrum Berl<strong>in</strong> aus<br />
auch immer ersche<strong>in</strong>en mochte:<br />
was Bonhoeffer seit 1935 im Predigersem<strong>in</strong>ar<br />
und anschließend <strong>in</strong> der illegalen<br />
Theologenausbildung tat, war ke<strong>in</strong>e Abwendung<br />
von den politischen E<strong>in</strong>sichten, die er gewonnen<br />
hatte, sondern blieb darauf <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er unzweideutigen<br />
Weise bezogen.<br />
Zu diesen Konsequenzen gehörte dann aber<br />
vor allem die Entscheidung, nicht vor Hitlers<br />
Krieg <strong>in</strong> die USA auszuweichen, um die Entscheidung<br />
zur Verweigerung des Kriegsdienstes nicht<br />
zur persönlichen Gefährdung werden zu lassen,<br />
sondern nach wenigen Wochen <strong>in</strong> New York<br />
im Sommer 1939 wieder nach <strong>Deutschland</strong> zurückzukehren,<br />
am Geschick des eigenen Volkes<br />
teilzunehmen, um für e<strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> nach Hitler<br />
zu wirken. Das war der Schritt, der Dietrich<br />
Bonhoeffer <strong>in</strong> die Konspiration gegen Hitler, <strong>in</strong><br />
Gefängnis und gewaltsamen Tod führte.<br />
Wie sehr er dabei früh gewonnene E<strong>in</strong>sichten<br />
weiterführte, lässt sich exemplarisch an se<strong>in</strong>em<br />
Verständnis politischer <strong>Macht</strong> verdeutlichen.<br />
Die Klarheit, die sich schon <strong>in</strong> dem Aufsatz<br />
über „Die <strong>Kirche</strong> vor der Judenfrage“ von 1933<br />
zeigt, setzt sich fort. In den Fragmenten zu der<br />
geplanten Ethik, an der Bonhoeffer während der<br />
Zeit der Konspiration und der Vorbereitung des<br />
Umsturzes arbeitete, wird die politische <strong>Macht</strong><br />
<strong>in</strong> die Lehre von den Mandaten e<strong>in</strong>geordnet, <strong>in</strong><br />
denen sich Gottes <strong>in</strong> Jesus Christus offenbartes<br />
Gebot konkretisiert. 12 Ke<strong>in</strong>e Rede ist da von e<strong>in</strong>er<br />
Eigengesetzlichkeit des Politischen; sondern<br />
die B<strong>in</strong>dung der politischen <strong>Macht</strong>ausübung<br />
an den göttlichen Auftrag, für Recht und Frieden<br />
zu sorgen, beherrscht auch hier alle Überlegungen.<br />
Bonhoeffers Denken kann man <strong>in</strong>sgesamt<br />
auf den Begriff e<strong>in</strong>er Ethik der Verantwortung<br />
br<strong>in</strong>gen. Sie ist früh angelegt und kommt <strong>in</strong> den<br />
Ethik-Fragmenten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er bee<strong>in</strong>druckenden<br />
Weise zur Entfaltung. Dass Bonhoeffer von der<br />
menschlichen Verantwortung so hoch denkt, hat<br />
wiederum mit se<strong>in</strong>em familiären H<strong>in</strong>tergrund<br />
ebenso zu tun wie mit se<strong>in</strong>er theologischen Prägung.<br />
Es hat vor allem auch damit zu tun, dass<br />
er den Weg, den er <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er persönlichen Entwicklung<br />
gegangen ist, als e<strong>in</strong>en Weg zur Mündigkeit<br />
erlebt hat, und dass er Mündigkeit als e<strong>in</strong><br />
entscheidendes Signum der Moderne ansah. 13<br />
Bonhoeffer sah <strong>in</strong> diesem Schritt zur Mündigkeit<br />
nicht e<strong>in</strong>e Gefährdung des Glaubens, sondern<br />
e<strong>in</strong>en Gew<strong>in</strong>n. Gerade angesichts der Mündigkeit<br />
des Menschen ist der<br />
Glaube ernst zu nehmen, und<br />
zwar nicht als e<strong>in</strong>e abgegrenzte<br />
Region <strong>in</strong> der menschlichen<br />
Exis tenz, als e<strong>in</strong> Reservat der<br />
Frömmigkeit am Sonntagmorgen,<br />
als e<strong>in</strong> Gefühl im Innern der<br />
Person, sondern als Lebensakt.<br />
Dem Dase<strong>in</strong> Christi für andere, so heißt Bonhoeffers<br />
Überzeugung, entspricht e<strong>in</strong>e Bereitschaft<br />
zum Dase<strong>in</strong> für andere, <strong>in</strong> der wir Verantwortung<br />
eben nicht nur als Vorsorge für das<br />
eigene Leben, sondern ebenso als Fürsorge für<br />
fremdes Leben verstehen. „Die letzte verantwortliche<br />
Frage ist nicht, wie ich mich heroisch aus der<br />
Affäre ziehe, sondern wie e<strong>in</strong>e künftige Generation<br />
weiterleben soll“: so heißt Bonhoeffers verantwortungsethischer<br />
Leitgedanke. 14 Er schließt<br />
die Bereitschaft e<strong>in</strong>, <strong>in</strong> der äußersten Situation<br />
zur Schuldübernahme bereit zu se<strong>in</strong>, nämlich<br />
dann, wenn Zuschauen und Tatenlosigkeit die<br />
größere Schuld wären. Im Begriff der Schuldübernahme<br />
kl<strong>in</strong>gt deutlich an, wie Bonhoeffer<br />
se<strong>in</strong> Handeln und das se<strong>in</strong>er Mitverschwörer <strong>in</strong><br />
der Konspiration gegen Hitler verstand.<br />
Dietrich Bonhoeffer, der jede Tötung e<strong>in</strong>es<br />
anderen Menschen für schuldhaft hielt, sah sich<br />
vor die Frage gestellt, ob es Situationen gibt, <strong>in</strong><br />
denen verantwortliches Handeln nur noch möglich<br />
ist, <strong>in</strong>dem man zur Schuldübernahme bereit<br />
ist. Bonhoeffer bejahte diese Frage und nahm die<br />
Konsequenz daraus auf sich. Diesen Schritt <strong>in</strong> die<br />
Schuldübernahme aus Verantwortung muss man<br />
im S<strong>in</strong>n haben, wenn man hört, dass Freiheit<br />
nicht dar<strong>in</strong> besteht, im Möglichen zu schweben,<br />
sondern das Wirkliche tapfer zu ergreifen. 15<br />
FOTO: BASTI ARLT<br />
WIR KÖNNEN AUCH ANDERS<br />
Posaunenmusik reicht bis zum Waldrand<br />
und die K<strong>in</strong>derstimmen dr<strong>in</strong>gen noch weiter.<br />
an die Nachbartische. „ . . . unser K<strong>in</strong>dergarten<br />
. . .“, „ . . . die Waschräume, s<strong>in</strong>d alt . . .“ „Sanierung<br />
auch auf. Die beiden geben sich die Hand,<br />
„ . . . Herr Bürgermeister . . .“. Die Frau lacht.<br />
In der trockenen Sommerluft schwellen die<br />
. . . unbed<strong>in</strong>gt nötig . . .“, „Beitrag . . . „ . . . Frau Pastor<strong>in</strong> . . .“ Der Mann schüttelt<br />
Stimmen an und verebben. Im Schaukasten<br />
bleicht das Plakat „Geme<strong>in</strong>defest“ aus. Die<br />
Holzbänke glühen <strong>in</strong> der Sonne. Die Dorfl <strong>in</strong>de<br />
und e<strong>in</strong>ige weit gespannte Sonnenschirme<br />
sorgen für Schatten. Vor der Losbude und<br />
beim R<strong>in</strong>gwerfen sammeln sich immer neue<br />
Gruppen. Das Küchenbuffet leert sich schnell.<br />
Große Kaffeekannen stehen unberührt herum.<br />
Kalte Getränke werden herbeigetragen.<br />
Die Zeit sche<strong>in</strong>t angehalten. Die Hitze firrt.<br />
Auf e<strong>in</strong>er Bank sucht e<strong>in</strong>e Männergruppe<br />
Schutz vor der Sonne. Jacketts werden abgelegt,<br />
Ärmel hochgekrempelt, die Krawattenknoten<br />
viel zu niedrig“. E<strong>in</strong>e Frau nähert sich. Sie tritt<br />
an den Tisch. Die Runde öffnet sich, macht e<strong>in</strong>en<br />
Sitzplatz frei. Hände werden geschüttelt,<br />
„ . . . Guten Tag! . . .“ „ . . . Hallo! . . .“, „ . . . Frau Pastor<strong>in</strong>,<br />
gut, dass Sie Zeit haben . . .“.<br />
Die Stimmen werden gedämpfter. „ . . . me<strong>in</strong>e<br />
Fraktion trägt das nicht mit . . . , ist im Geme<strong>in</strong>dehaushalt<br />
nicht vorgesehen ...“, „... muss man<br />
mal sehen . . .“, „ . . . der Geme<strong>in</strong>dekirchenrat<br />
hat . . . so könnte das gehen . . .“, „ . . . immerh<strong>in</strong><br />
s<strong>in</strong>d das alles unsere K<strong>in</strong>der . . .“. Das Gespräch<br />
wechselt <strong>in</strong> den Flüsterton. Plötzlich erkl<strong>in</strong>gt<br />
e<strong>in</strong>e Stimme laut: „Ja, so machen wir das.“<br />
kräftig die angebotene Hand. „Abgemacht!“,<br />
dr<strong>in</strong>gt an die Nachbartische.<br />
Etwas später, auf dem Tisch steht das erste<br />
Bierglas. E<strong>in</strong>ige K<strong>in</strong>der kommen und treten auf<br />
die kle<strong>in</strong>e Bühne. „Der Himmel geht über allen<br />
auf“, s<strong>in</strong>gen die K<strong>in</strong>derstimmen. E<strong>in</strong>ige Frauen<br />
unterstützen den Gesang. Bei dem Wort „Himmel“<br />
recken die K<strong>in</strong>der ihre Hände nach oben,<br />
zeichnen e<strong>in</strong>en Bogen <strong>in</strong> den Himmel. „Unser<br />
K<strong>in</strong>dergarten s<strong>in</strong>gt nun für euch alle . . .“, sagt<br />
die Pastor<strong>in</strong> und dankt „unserem Bürgermeister,<br />
für die gute Zusammenarbeit . . .“. Noch<br />
vom Waldrand her kann man den Gesang der<br />
sitzen locker. Wortfetzen dr<strong>in</strong>gen Die Frau erhebt sich, e<strong>in</strong>er der Männer steht K<strong>in</strong>der hören. <br />
VON HENNING<br />
KIENE<br />
44<br />
45