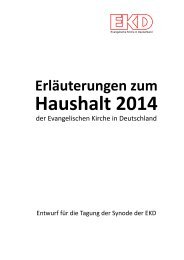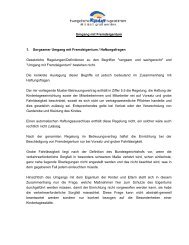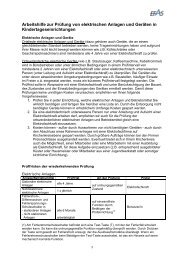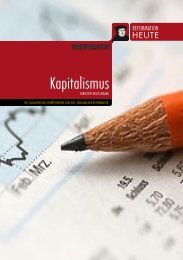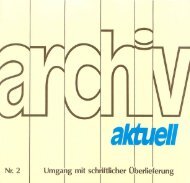Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
POLITIK POLITIK<br />
UMF RAGE<br />
Die Mehrheit der Deutschen hält den Islam für bedrohlich. Zu<br />
Für die meisten lautet die Lösung: Ke<strong>in</strong>e <strong>Macht</strong><br />
e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensiveren Praxis des Christentums führt das nicht.<br />
für irgende<strong>in</strong>e Religion VON DETLEF POLLACK<br />
EINZELERGEBNISSE<br />
Anteil der Deutschen, die folgenden Aussagen „voll und ganz“ zustimmen<br />
„Ich wünsche mir e<strong>in</strong>e größere<br />
religiöse und kulturelle Vielfalt<br />
<strong>in</strong> me<strong>in</strong>er Umgebung“<br />
„Ich greife für mich selbst auf<br />
Lehren verschiedener religiöser<br />
Traditionen zurück“<br />
„Ich glaube, dass unser<br />
Land durch fremde Kulturen/<br />
Nationen bedroht ist“<br />
OST<br />
OST<br />
WEST<br />
WEST<br />
OST<br />
WEST<br />
Quelle: Wahrnehmung und Akzeptanz religiöser Vielfalt <strong>in</strong> ausgewählten Ländern Europas, Münster 2010<br />
2 %<br />
2 %<br />
5 %<br />
8 %<br />
50,1 %<br />
40,7 %<br />
W<br />
ie reagieren die Deutschen auf die anwachsende<br />
religiöse Vielfalt? S<strong>in</strong>d sie<br />
neugierig und kreieren sie e<strong>in</strong>e Patchworkreligiosität,<br />
die sich aus allen Religionen<br />
„das Beste“ nimmt? Verhalten sie sich ablehnend<br />
gegenüber dem Fremden oder bes<strong>in</strong>nen sie sich<br />
auf das Eigene?<br />
Die Expertenme<strong>in</strong>ungen über die Auswirkungen<br />
der neuen religiösen Pluralisierung <strong>in</strong><br />
<strong>Deutschland</strong> lassen sich <strong>in</strong> drei Hypothesen fassen.<br />
Die erste kann als „Individualisierungsthese“<br />
bezeichnet werden und geht davon aus, dass<br />
die neue kulturelle und religiöse Vielfalt von den<br />
Menschen als Bereicherung und Ergänzung der<br />
eigenen Religiosität wahrgenommen wird. Das<br />
moderne Individuum stellt sich demnach aus der<br />
zunehmenden Vielfalt religiöser Angebote se<strong>in</strong>e<br />
eigene Religiosität zusammen. Die Gegenthese<br />
lautet, dass das Fremde nicht zur Horizonterweiterung<br />
genutzt, sondern als Bedrohung erlebt<br />
wird. Die Vertreter der These vom „cultural defense“<br />
postulieren, dass das Bedrohungsgefühl<br />
zu e<strong>in</strong>er starken Abwehr führe und die eigene<br />
christliche Identität stärke. Doch die Begegnung<br />
mit dem Fremden könnte auch – das wäre die<br />
dritte These – dazu führen, dass man angesichts<br />
der als bedrohlich wahrgenommenen Vielfalt des<br />
Religiösen auf e<strong>in</strong>e schärfere Trennung zwischen<br />
Religion und <strong>Politik</strong> sowie auf die Gewährleistung<br />
der Pr<strong>in</strong>zipien <strong>in</strong>dividueller Religionsfreiheit<br />
drängt. An die Stelle der religiösen Selbstbehauptung<br />
träte dann die säkulare Abgrenzung<br />
von aller Religion.<br />
Welche der drei hier aufgestellten Hypothesen<br />
kann die höchste Erklärungskraft für sich beanspruchen?<br />
Dafür soll e<strong>in</strong> Blick auf die aktuellen<br />
Umfragen geworfen werden, <strong>in</strong> denen repräsentativ<br />
deutsche Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger befragt<br />
wurden.<br />
Als Erstes spr<strong>in</strong>gt <strong>in</strong>s Auge, dass die Individualisierungs-These,<br />
so e<strong>in</strong>leuchtend sie zunächst<br />
kl<strong>in</strong>gt und so vehement sie vielfach vertreten<br />
wird, kaum der Faktenlage entspricht. Die Mehrheit<br />
der Deutschen wünscht sich ke<strong>in</strong>e größere<br />
religiöse Vielfalt. Lediglich rund 20 Prozent der<br />
Deutschen greifen nach eigener Aussage <strong>in</strong> ihrem<br />
Glauben auf Lehren unterschiedlicher Religionen<br />
zurück. Und nur selten gehen „traditionelle“<br />
christliche Praktiken mit „alternativen“ Formen<br />
von Religiosität Hand <strong>in</strong> Hand. Selbst dort, wo es<br />
zum Aufbau e<strong>in</strong>er synkretistischen Religiosität<br />
kommt, besteht ke<strong>in</strong> Interesse an e<strong>in</strong>er Erweiterung<br />
der religiösen Optionen.<br />
Insgesamt ergibt sich für <strong>Deutschland</strong> nicht<br />
das Bild e<strong>in</strong>er offenen Gesellschaft, die neugierig<br />
auf fremde Religionen schaut. Ganz im Gegenteil.<br />
Weit über zwei Drittel der Deutschen sehen<br />
<strong>in</strong> der wachsenden religiösen Vielfalt e<strong>in</strong>e Ursa-<br />
FOTO: HARTMUT NAEGELE/LAIF, JULIA HOLTKÖTTER<br />
che von Konflikten. Über 40 Prozent der Deutschen<br />
haben sogar das Gefühl, dass das eigene<br />
Land durch fremde Kulturen bedroht wird. Bemerkenswerterweise<br />
f<strong>in</strong>det sich die Furcht vor<br />
dem Konfliktpotenzial religiöser Vielfalt sowie<br />
vor dem Verlust der eigenen kulturellen Fundamente<br />
bei religiösen Personen <strong>in</strong> gleichem Maße<br />
wie bei den weniger religiösen oder areligiösen<br />
Menschen. Das heißt, das Bedrohungsgefühl<br />
geht nicht e<strong>in</strong>her mit e<strong>in</strong>er Intensivierung des<br />
Glaubens oder der religiösen Praktiken. Auch die<br />
zweite These, das Theorem der religiösen Selbstbehauptung,<br />
bei dem es sich immerh<strong>in</strong> um e<strong>in</strong>es<br />
der best-etablierten Argumente <strong>in</strong> der religionssoziologischen<br />
Diskussion handelt, lässt sich<br />
also für <strong>Deutschland</strong> empirisch nicht bestätigen.<br />
Doch das bedeutet wiederum nicht, dass die<br />
empfundenen Spannungen gegenüber anderen<br />
Religionen ke<strong>in</strong>e Auswirkungen auf das religiöse<br />
Feld hätten. Immerh<strong>in</strong> sehen etwa drei Viertel<br />
der Westdeutschen und sogar mehr als die Hälfte<br />
der Ostdeutschen im Christentum das Fundament<br />
unserer Kultur, während das Bild von den<br />
nichtchristlichen Religionen <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> sich<br />
immer mehr verschlechtert. Den Islam etwa hält<br />
die Mehrheit der Deutschen mittlerweile für e<strong>in</strong>e<br />
bedrohliche Religion. Komplementär dazu entwickelt<br />
sich das Image des Christentums zum<br />
Positiven. So negativ der Islam beurteilt wird, so<br />
positiv erstrahlt das Christentum. In dieser Korrelation<br />
kann man durchaus e<strong>in</strong>e Art religiöser<br />
Selbstbehauptung und damit e<strong>in</strong>e Unterstützung<br />
der zweiten These sehen. Allerd<strong>in</strong>gs wird man<br />
hier das Theorem <strong>in</strong>sofern wieder relativieren<br />
müssen, als sich dieser Mechanismus auf der Ebene<br />
der Weltdeutungsmuster vollzieht, jedoch auf<br />
die religiöse Praxis kaum Auswirkungen zeigt.<br />
Wie sieht es nun mit der dritten These aus, dass<br />
die als Bedrohung empfundene Vielfalt zu e<strong>in</strong>er<br />
stärkeren E<strong>in</strong>forderung säkularer Abgrenzung<br />
führt? Tatsächlich sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e klare Trennung<br />
zwischen Religion und <strong>Politik</strong> für viele Menschen<br />
das geeignete Mittel zu se<strong>in</strong>, die Grundwerte der<br />
eigenen Kultur gegen fremde E<strong>in</strong>flüsse zu verteidigen.<br />
Rund drei Viertel der Deutschen s<strong>in</strong>d<br />
gegen e<strong>in</strong>e explizite Verankerung des Gottesbegriffs<br />
<strong>in</strong> der europäischen Verfassung. Ebenso<br />
wollen die Deutschen <strong>in</strong> ihrer großen Mehrheit<br />
ke<strong>in</strong>e Vermischung von <strong>Politik</strong>, Wissenschaft,<br />
Recht oder Wirtschaft mit religiösen Normen<br />
und Werten.<br />
Die Fakten über das deutsche Glaubensleben<br />
kl<strong>in</strong>gen für e<strong>in</strong>e sich globalisierende Welt bedenklich.<br />
In <strong>Deutschland</strong> werden Spannungen<br />
zwischen Religionen heutzutage als die entscheidende<br />
Ursache für Konflikte angesehen, bedeutsamer<br />
als Spannungen zwischen verschiedenen<br />
Volksgruppen und das <strong>Macht</strong>streben e<strong>in</strong>zelner<br />
Länder und genauso bedeutsam wie der Streit<br />
über den Zugang zu unverzichtbaren Rohstoffen<br />
wie zum Beispiel Öl. Die Vorbehalte gegenüber<br />
anderen Religionen gehen so weit, dass nur e<strong>in</strong><br />
knappes Drittel der Deutschen e<strong>in</strong>e friedliche<br />
Koexistenz zwischen Christentum und Islam für<br />
möglich hält. Die anderen befürchten, es werde<br />
immer wieder zu Konflikten kommen. Immerh<strong>in</strong><br />
ist die große Mehrheit der Menschen <strong>in</strong><br />
<strong>Deutschland</strong> ke<strong>in</strong>eswegs für e<strong>in</strong>e Ausgrenzung<br />
des Islam aus der Gesellschaft. Drei Viertel der<br />
Bevölkerung etwa sprechen sich für die Durchführung<br />
e<strong>in</strong>es Islam-Unterrichts an den öffentlichen<br />
Schulen aus. Toleranz gegenüber fremden<br />
Überzeugungen und Weltanschauungen gilt für<br />
die meisten trotz aller Skepsis als hoher Wert.<br />
PROF. DR. DETLEF<br />
POLLACK ist Religionssoziologe<br />
und stellvertretender<br />
Sprecher<br />
des Exzellenzclusters<br />
„Religion und <strong>Politik</strong>“<br />
an der Westfälischen<br />
Wilhelms-Universität<br />
Münster.<br />
90<br />
91