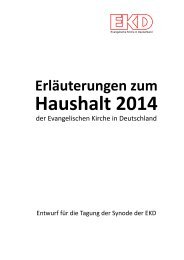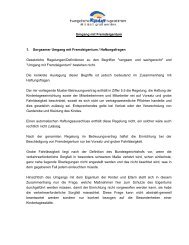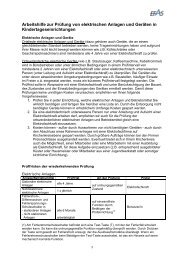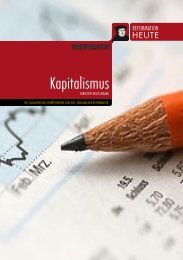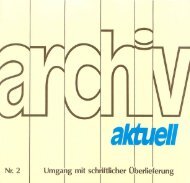Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Macht</strong><br />
MACHT<br />
ANGEBOT<br />
ABGELEHNT<br />
Argula von Grumbach hatte viel zu sagen und schrieb sich die<br />
F<strong>in</strong>ger wund. Die Bildungselite verweigerte ihr die<br />
Aufmerksamkeit – und demonstrierte so ihre <strong>Macht</strong><br />
„Ich habe euch ke<strong>in</strong> Weibergeschwätz geschrieben,<br />
sondern das Wort Gottes als e<strong>in</strong> Glied der<br />
<strong>Kirche</strong>“, schließt die 31-jährige Argula von Grumbach<br />
ihr Sendschreiben an die Ingolstädter Gelehrten,<br />
<strong>in</strong> dem sie 1523 e<strong>in</strong>en Magister gegen e<strong>in</strong><br />
ketzergerichtliches Verfahren durch die Universität<br />
verteidigt. Die Fränkische Freifrau war e<strong>in</strong>e<br />
der bekanntesten Flugschriftenautor<strong>in</strong>nen der<br />
<strong>Reformation</strong>szeit und weit über die Grenzen von<br />
VON KRISTINA DRONSCH<br />
Franken h<strong>in</strong>aus bekannt. E<strong>in</strong>e von vielen Frauen,<br />
die sich besonders <strong>in</strong> der Frühzeit der <strong>Reformation</strong><br />
politisch e<strong>in</strong>mischten und zu Wort meldeten.<br />
Es war – ohne das bequeme Nackenpolster von<br />
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – e<strong>in</strong> großes<br />
Wagnis, das Frauen wie Argula von Grumbach<br />
e<strong>in</strong>gegangen s<strong>in</strong>d. Viele haben dafür e<strong>in</strong>en hohen<br />
Preis gezahlt. Was hat sie dennoch dazu bewogen?<br />
Die Präsenz des Reformators Mart<strong>in</strong> Luther<br />
ILLUSTRATION: HENRIK ABRAHAMS<br />
war es nicht. Argula von Grumbach konnte sogar<br />
sagen: „Auch wenn es dazu kommen sollte,<br />
wovor Gott sei, dass Luther widerruft, so soll es<br />
mir nichts zu schaffen machen. Ich baue nicht auf<br />
se<strong>in</strong>, me<strong>in</strong> oder sonst e<strong>in</strong>es Menschen Verstand,<br />
sondern alle<strong>in</strong> auf den wahren Felsen Christus<br />
selber.“<br />
Ihr Recht, sich zu Wort zu melden, gew<strong>in</strong>nen<br />
die Frauen aus der reformatorischen Grundüberzeugung,<br />
dass jeder Mensch unmittelbar vor<br />
Gott steht. Dieses unmittelbare Verhältnis zu<br />
Gott und se<strong>in</strong>em Wort schließt e<strong>in</strong>, dass jede und<br />
jeder befähigt und gehalten ist, <strong>in</strong> den lebensbestimmenden<br />
Bezügen davon auch Zeugnis zu geben:<br />
„Wer mich bekennt vor den Menschen, den<br />
will auch ich bekennen vor me<strong>in</strong>em<br />
himmlischen Vater“, zitiert<br />
Argula von Grumbach aus dem<br />
Matthäus evangelium (Kapitel 10,<br />
Vers 32). Obwohl sie lange mit sich<br />
gerungen habe – dieses Jesuswort<br />
habe sie veranlasst, zu schreiben.<br />
Am Anfang war Gottes Wort. Mit<br />
diesem Wort machen die Frauen der <strong>Reformation</strong>szeit<br />
e<strong>in</strong>en Anfang, <strong>in</strong>dem sie <strong>in</strong> politisch-gesellschaftlichen<br />
Kontexten davon Zeugnis geben.<br />
Wer Zeugnis gibt, unterrichtet, bekräftigt<br />
oder widerlegt nicht nur, sondern schafft mit<br />
dem Wissen, das dadurch ermöglicht wird, zugleich<br />
e<strong>in</strong>e Grundlage von Geme<strong>in</strong>schaft.<br />
Dieser Geme<strong>in</strong>schaftsgedanke f<strong>in</strong>det sich im<br />
Gedanken vom Priestertum aller Getauften ausgedrückt.<br />
Der seltsam altertümliche Begriff, der<br />
mit Blick auf das <strong>Reformation</strong>sjubiläum konzentriert<br />
durch evangelische Denkschriften und Impulspapiere<br />
geistert, basiert zum e<strong>in</strong>en auf dem<br />
Gedanken, dass die Beziehung zwischen Gott<br />
und Mensch ke<strong>in</strong>er Vermittlung durch Amtspriester<br />
bedarf. Im Zuge dessen wird das Priestertum<br />
aller Getauften <strong>in</strong> unserer Gegenwart<br />
gerne als e<strong>in</strong> <strong>in</strong>dividuelles Freiheitsrecht für religiöse<br />
Mündigkeit verstanden.<br />
Zugleich aber schw<strong>in</strong>gt <strong>in</strong> dem Gedanken<br />
vom Priestertum aller Getauften e<strong>in</strong> sozialer<br />
Aspekt mit, der <strong>in</strong> sich schon e<strong>in</strong>e politische<br />
Dimension trägt. Denn das Priesteramt ist e<strong>in</strong><br />
Amt der Vermittlung. Es wird dort konkret, wo<br />
jemand vom Wort Gottes, vom Evangelium vor<br />
Anderen und für Andere Zeugnis gibt. Das kann<br />
nur gel<strong>in</strong>gen, wo me<strong>in</strong> Zeugnis anerkannt wird.<br />
Das allgeme<strong>in</strong>e Priestertum ist also selbst als e<strong>in</strong>e<br />
soziale Rolle anzusehen, die von ethisch-politischen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen und Anerkennungsmechanismen<br />
geprägt ist.<br />
Deswegen greift es zu kurz, wenn der Gedanke<br />
vom Priestertum aller Getauften e<strong>in</strong>fach nur<br />
als persönliche Ermutigung für die Frauen der<br />
„DAS VERTRAUEN<br />
BILDET DAS<br />
FUNDAMENT DES<br />
ALLGEMEINEN<br />
PRIESTERTUMS.“<br />
<strong>Reformation</strong>szeit verstanden wird, sich zu Wort<br />
zu melden. Denn nicht so sehr die E<strong>in</strong>zelne oder<br />
den E<strong>in</strong>zelnen nimmt der Gedanke <strong>in</strong> den Blick.<br />
Er ist vielmehr <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er sozialen und politischen<br />
Dimension wiederzuentdecken. Gerade weil es<br />
nicht der priesterlichen Weihe bedarf, um die<br />
Welt im Lichte des Glaubens zu deuten und zu<br />
verstehen, s<strong>in</strong>d alle Christ<strong>in</strong>nen und Christen<br />
geradezu aufgefordert, vom Wort Gottes Zeugnis<br />
zu geben.<br />
Doch nur mit Hilfe e<strong>in</strong>es sozialen Bandes, das<br />
zwischen den Zeugnisgebenden und den Zeugnisempfängern<br />
existiert, ist Zeugnisgeben möglich.<br />
Dieses soziale Band konkretisiert sich als<br />
„Vertrauen schenken“. E<strong>in</strong>em Zeugnis Vertrauen<br />
zu schenken impliziert, an die Integrität<br />
e<strong>in</strong>er Person zu glauben.<br />
Das ist e<strong>in</strong>e Frage der E<strong>in</strong>stellung.<br />
Diese E<strong>in</strong>stellung aber trägt die<br />
Züge e<strong>in</strong>er Gabe. Die ethische<br />
Gabe des Vertrauenschenkens ist<br />
e<strong>in</strong> <strong>in</strong>tersubjektives Phänomen.<br />
Sie bildet den Kern des Priestertums<br />
aller Getauften, denn das Vertrauen <strong>in</strong> die<br />
Andere oder den Anderen bildet das Fundament<br />
e<strong>in</strong>es gel<strong>in</strong>genden allgeme<strong>in</strong>en Priestertums.<br />
Von der großen Philosoph<strong>in</strong> Hannah Arendt<br />
stammen die Worte „<strong>Politik</strong> heißt Anfangen-Können“.<br />
Das Anfangen-Können schafft die Bed<strong>in</strong>gungen<br />
für Kont<strong>in</strong>uität, für Er<strong>in</strong>nerung und damit<br />
für Geschichte. Doch das Moment des Beg<strong>in</strong>nens,<br />
das sich konkretisiert im „Sich-E<strong>in</strong>setzen-füretwas“<br />
wird nur da gel<strong>in</strong>gen, wo das soziale Band<br />
des Vertrauens diesen Anfang weiterträgt.<br />
Argula von Grumbach wurde dieses soziale<br />
Band des Vertrauens nicht entgegengebracht.<br />
Sie verstummte e<strong>in</strong> Jahr, nachdem sie angefangen<br />
hatte, sich zu Wort zu melden. E<strong>in</strong> beendeter<br />
Anfang, der e<strong>in</strong>es Neuanfangs bedarf. Argula<br />
schreibt: „Ja, wenn ich alle<strong>in</strong> sterbe, so werden<br />
doch hundert Frauen wider sie schreiben. Denn<br />
ihrer s<strong>in</strong>d viele, die belesener und geschickter als<br />
ich s<strong>in</strong>d.“ Auch das ist von ihr zu lernen: Die Fähigkeit,<br />
immer wieder neu anfangen zu können<br />
und eben nicht e<strong>in</strong> für alle Mal def<strong>in</strong>iert zu se<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Rolle als Frau, setzt voraus, Vertrauen<br />
zu haben, dass sich ethisch-politische E<strong>in</strong>stellungen<br />
und Anerkennungsmechanismen ändern<br />
werden. Das impliziert die bleibende Aufgabe<br />
und Verantwortung, selbst aktiv dazu beizutragen<br />
– so wie es die vielen Frauen im Laufe der<br />
500-jährigen Geschichte der <strong>Reformation</strong> getan<br />
haben. Aus diesem Grund ist der Gedanke vom<br />
Priestertum aller Getauften niemals jenseits des<br />
Politischen zu denken oder <strong>in</strong> den vorpolitischen<br />
Raum zu verweisen, sondern birgt <strong>in</strong> sich selbst<br />
e<strong>in</strong>e politische Dimension.<br />
DR. KRISTINA<br />
DRONSCH ist<br />
Referent<strong>in</strong> für<br />
„Frauen und <strong>Reformation</strong>sdekade“<br />
bei den <strong>Evangelische</strong>n<br />
Frauen <strong>in</strong><br />
<strong>Deutschland</strong> (efid).<br />
Weitere „starke<br />
Frauengestalten“ der<br />
<strong>Reformation</strong>szeit unter<br />
www.frauen-undreformation.de<br />
52<br />
53