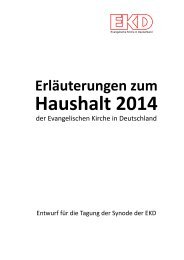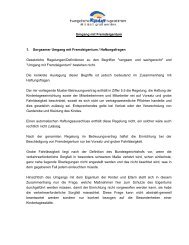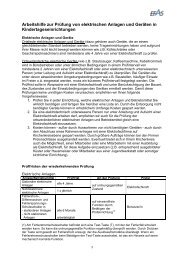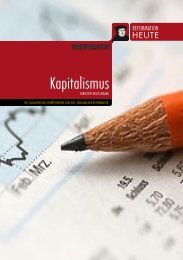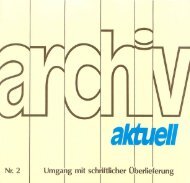Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
MACHT<br />
EINE<br />
FÜR<br />
VIELE<br />
Die Rolle der<br />
christlichen <strong>Kirche</strong>n <strong>in</strong><br />
der Öffentlichkeit<br />
VON JUDITH KÖNEMANN<br />
E<br />
s ist e<strong>in</strong> genu<strong>in</strong>es Charakteristikum der<br />
christlichen Religion, e<strong>in</strong>e öffentliche Religion<br />
zu se<strong>in</strong> und aus ihrem Selbstverständnis<br />
heraus den Anspruch zu vertreten, die<br />
Welt <strong>in</strong> <strong>Politik</strong> und Gesellschaft mitzugestalten.<br />
Unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
von (religiöser) Pluralisierung und<br />
Individualisierung s<strong>in</strong>d die <strong>Kirche</strong>n mehr denn<br />
je auch Interessensvertreter für ihre eigenen<br />
Belange, vor allem aber auch für die Wahrnehmung<br />
ihrer (religiösen) Überzeugungen <strong>in</strong> der<br />
gesellschaftlichen und politischen Öffentlichkeit.<br />
Zwar wird die Rolle der christlichen <strong>Kirche</strong>n <strong>in</strong><br />
der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert, bis<br />
heute lässt sich jedoch feststellen, dass die Präsenz<br />
und die Interessenvertretung der <strong>Kirche</strong>n <strong>in</strong><br />
<strong>Politik</strong> und Öffentlichkeit nach wie vor sehr hoch<br />
ist. Wie dies von den <strong>Kirche</strong>n umgesetzt und vermittelt<br />
wird, soll im Folgenden am Beispiel der<br />
langjährigen Ause<strong>in</strong>andersetzungen über Integration,<br />
Asyl und Zuwanderung aufgezeigt werden.<br />
Denn an dieser Debatte lässt sich beispielhaft<br />
zeigen, wie sehr sich die <strong>Kirche</strong>n konstant<br />
an öffentlichen Disputen beteiligen, und wie die<br />
FOTO: GETTY, SARAH BATELKA<br />
Beteiligung der <strong>Kirche</strong>n am politischen Prozess,<br />
häufig im Umfeld von Gesetzgebungsverfahren,<br />
ausgerichtet ist.<br />
Neben der beständigen Beteiligung am öffentlichen<br />
Diskurs über Stellungnahmen wurden<br />
die <strong>Kirche</strong>n punktuell bei bestimmten Gesetzesformulierungen<br />
auch <strong>in</strong> den politischen Prozess<br />
direkt e<strong>in</strong>gebunden, so z.B. die evangelische <strong>Kirche</strong><br />
durch ihre Mitarbeit <strong>in</strong> der „Unabhängige(n)<br />
Kommission Zuwanderung“, die den Auftrag<br />
hatte, Empfehlungen für e<strong>in</strong>en gesamtgesellschaftlich<br />
konsensfähigen Gesetzesentwurf zu<br />
erarbeiten. Neben dieser unmittelbaren E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung<br />
haben die <strong>Kirche</strong>n auch immer wieder<br />
spezifische Schwerpunktthemen <strong>in</strong> die Debatte<br />
e<strong>in</strong>gebracht und diese damit fokussiert, so zum<br />
Beispiel die evangelische <strong>Kirche</strong><br />
„<br />
DIE KIRCHE<br />
TRITT ALS AN<br />
WÄLTIN FÜR<br />
MIGRANTEN<br />
EIN.<br />
“<br />
<strong>in</strong> den 80er Jahren durch die Forderung<br />
e<strong>in</strong>er notwendigen Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
mit zunehmender<br />
Fremdenfe<strong>in</strong>dlichkeit und die Anerkennung<br />
der Notwendigkeit von<br />
Integration und entsprechender<br />
Möglichkeiten dazu oder die im<br />
Laufe der Jahre zunehmende positive<br />
Anerkennung von Pluralität<br />
für e<strong>in</strong> gel<strong>in</strong>gendes Zusammenleben<br />
von Menschen mit unterschiedlichen Kulturen.<br />
So zum Beispiel Präses Manfred Kock 2001<br />
im Rahmen der Zuwanderungsdebatte: „Wir<br />
brauchen e<strong>in</strong> Gesellschafts- und Staatsverständnis,<br />
das der Realität e<strong>in</strong>er ethnisch, kulturell und<br />
religiös vielfältiger gewordenen Gesellschaft entspricht.<br />
(…) Zugewanderte müssen zu mitgestaltenden,<br />
mittragenden Teilen unserer Gesellschaft<br />
werden. Integration ist e<strong>in</strong> Prozess, der auf Gegenseitigkeit<br />
und Vertrauensbildung angewiesen<br />
ist. Die <strong>Kirche</strong>n s<strong>in</strong>d aktiv, um Zusammenleben<br />
zu gestalten und Verständnis zu fördern.“ Nach<br />
dem 11. September 2001 machte die evangelische<br />
<strong>Kirche</strong> auch früh auf die notwendige Reflexion<br />
des Themas Religion und der öffentlichen Rolle<br />
von Religion(en) und deren Anerkennung im<br />
Kontext gesellschaftlichen Zusammenlebens<br />
aufmerksam: „Die Religionszugehörigkeit ist e<strong>in</strong><br />
wichtiger Integrationsfaktor, der im Integrationsprozess<br />
besondere Antworten und Berücksichtigung<br />
f<strong>in</strong>den muss. (…) Denn unbeschadet<br />
der verbürgten Freiheit persönlicher religiöser<br />
Überzeugungen ist die öffentliche Präsenz von<br />
Religionen manchmal Anlass für Kontroversen.<br />
(…) Der E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>es islamischen Religionsunterrichts<br />
an öffentlichen Schulen nach Art.<br />
7 Abs. 3 GG kommt e<strong>in</strong>e besondere <strong>in</strong>tegrationspolitische<br />
Bedeutung zu.“<br />
Inhaltlich positioniert sich die <strong>Kirche</strong> sowohl<br />
mit religiösen wie auch nicht-religiösen Argumentationen;<br />
entgegen der vielleicht verbreiteten<br />
Annahme, dass die religiösen Argumente und<br />
Bezüge überwiegen, zeigen die Analysen, dass<br />
die Argumentationen ausgesprochen anlass- und<br />
diskursbezogen s<strong>in</strong>d und sich somit vielfach auch<br />
im Bereich des säkularen Expertenwissens bewegen.<br />
Gleichwohl vertritt die <strong>Kirche</strong> klar ihre Positionen<br />
und Interessen <strong>in</strong> den Debatten und wird<br />
mit ihrer klaren Option für den Anderen, den<br />
Fremden, und für Integration kenntlich, ebenso<br />
mit ihrer Forderung nach der Wahrung der<br />
Rechte der Migrant<strong>in</strong>nen und vor allem mit der<br />
Forderung nach dem Recht auf Familienzusammenführung.<br />
Alle drei Optionen werden auch je<br />
nach Anlass und Zielgruppe religiös begründet,<br />
zum Beispiel auf folgende Weise: „Migration und<br />
Fremdheit gehören zu den Grunderfahrungen<br />
des Glaubens. Diese<br />
wesensmäßige Nähe zu Fremden<br />
verpflichtet die <strong>Kirche</strong>n zur Solidarität<br />
mit den Migrant<strong>in</strong>nen und<br />
Migranten.“ So tritt die <strong>Kirche</strong><br />
– auch <strong>in</strong> ihrem Selbstverständnis<br />
– als öffentliche Anwält<strong>in</strong> für<br />
Migrant<strong>in</strong>nen und deren Rechte<br />
wie <strong>in</strong>sgesamt für Humanität<br />
e<strong>in</strong>: „Humanitäre Verpflichtungen<br />
s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>e Verhandlungssache, sondern moralisch<br />
und politisch unabd<strong>in</strong>gbar.“ Es wird aber<br />
auch die Rolle der Expert<strong>in</strong> e<strong>in</strong>genommen, wenn<br />
beispielsweise populistische Argumente wie die<br />
Rede von der drohenden Überfremdung bereits<br />
Mitte der 80er Jahre durch die sachliche Expertise<br />
e<strong>in</strong>er von der <strong>Kirche</strong> e<strong>in</strong>gesetzten Expertenkommission<br />
entkräftet wurden. Die Debatte über<br />
die Rolle der Religion <strong>in</strong> der Gesellschaft nach<br />
dem 11. September wurde auch zum Anlass zur<br />
Selbstreflexion, wenn etwa die <strong>Kirche</strong> angesichts<br />
der zunehmenden Zahl von Muslimen und damit<br />
e<strong>in</strong>er steigenden Präsenz des Islams <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong><br />
auch ihre eigene Rolle und die Position<br />
christlicher Religion <strong>in</strong> der Gesellschaft reflektiert<br />
und dabei die Anerkenntnis von Pluralität<br />
anmahnt: „Toleranz bedeutet nicht Gleichgültigkeit,<br />
sondern will das Zusammen leben höchst<br />
unterschiedlicher und e<strong>in</strong>ander ausschließender<br />
weltanschaulicher B<strong>in</strong>dungen und religiöser Bekenntnisse<br />
<strong>in</strong> gegenseitigem Respekt ermöglichen.“<br />
Die Beispiele der evangelischen <strong>Kirche</strong> zeigen<br />
e<strong>in</strong>e nach wie vor hohe Bedeutung der christlichen<br />
<strong>Kirche</strong>n <strong>in</strong> den gesellschaftspolitischen Debatten<br />
der bundesrepublikanischen Gesellschaft.<br />
Inwieweit der öffentliche Anspruch der <strong>Kirche</strong>n<br />
allerd<strong>in</strong>gs bei fortdauernden Entkirchlichungsprozessen<br />
auf Zukunft h<strong>in</strong> durch die Bevölkerung<br />
gedeckt se<strong>in</strong> wird, wird zu diskutieren se<strong>in</strong>.<br />
PROF. DR. JUDITH<br />
KÖNEMANN ist<br />
Theo log<strong>in</strong> und Soziolog<strong>in</strong><br />
im Exzellenzcluster<br />
„Religion und<br />
<strong>Politik</strong>” der Universität<br />
Münster.<br />
54<br />
55