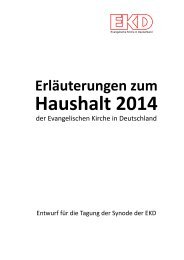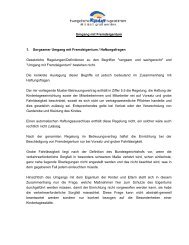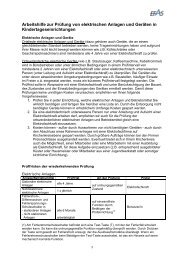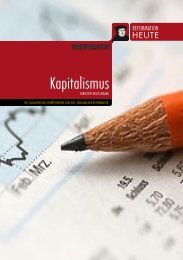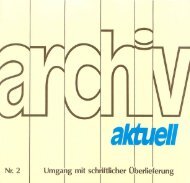Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Reformation. Macht. Politik - Evangelische Kirche in Deutschland
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
POLITIK POLITIK<br />
ABGESEGNET?<br />
Auf Postkarten<br />
wurde die E<strong>in</strong>igkeit<br />
von <strong>Kirche</strong> und Staat<br />
demonstriert: E<strong>in</strong> Pfarrer<br />
bei der Segnung von<br />
Feldsoldaten (l.); Banner<br />
„Mit Gott für König und<br />
Vaterland“ (M.); Das<br />
gezückte Gewehr unter<br />
den Worten „De<strong>in</strong> Wille<br />
geschehe“ (r.)<br />
MIT GOTT IN DEN KRIEG<br />
Als 1914 die ersten deutschen Soldaten <strong>in</strong> die Schlacht zogen, standen die <strong>Kirche</strong>n<br />
h<strong>in</strong>ter ihnen. Aber nicht geschlossen VON SEBASTIAN KRANICH<br />
D<br />
ie evangelischen <strong>Kirche</strong>n im Deutschen<br />
Reich haben von jeher e<strong>in</strong>e nationale Haltung<br />
e<strong>in</strong>genommen. Sie waren überzeugt,<br />
ihrem christlichen Charakter nichts zu vergeben,<br />
wenn sie dem Kaiser gaben, was des Kaisers<br />
war.“ So schrieb der Generalsuper<strong>in</strong>tendent<br />
der <strong>Kirche</strong>nprov<strong>in</strong>z Schlesien, Mart<strong>in</strong> Schian,<br />
im Rückblick auf den vergangenen Weltkrieg.<br />
Damit lag er richtig: Vom Topos der „teutschen<br />
Nation“ <strong>in</strong> der Wittenberger <strong>Reformation</strong> über<br />
den Konnex von Pietismus und Patriotismus bis<br />
h<strong>in</strong> zu den Befreiungskriegen war der deutsche<br />
Protestantismus mit dem Gedanken der Nation<br />
verbunden. Recht und Pflicht zum Krieg für das<br />
Vaterland standen 1914 weith<strong>in</strong> außer Frage. Die<br />
altpreußische Landeskirche etwa ergänzte vor<br />
Kriegsbeg<strong>in</strong>n ihre Wehrmachtsfürbitte lediglich<br />
um „Luftfahrzeuge“. Moderner Pazifismus und<br />
Ökumene blieben als Novitäten e<strong>in</strong>e Sache von<br />
M<strong>in</strong>derheiten.<br />
Im Krieg leisteten die Volkskirchen – wie<br />
auch <strong>in</strong> Frankreich oder England – mit großer<br />
Selbstverständlichkeit Unterstützung an Front<br />
und „Heimatfront“: Gottesdienste bei Siegen und<br />
Niederlagen, Kriegsbetstunden und vielfältige<br />
sozialdiakonische Hilfen auf Geme<strong>in</strong>de ebene<br />
waren dabei die e<strong>in</strong>e Seite der Medaille, das<br />
enge Zusammenspiel von <strong>Kirche</strong>n- und Reichskriegsbehörden<br />
die andere. So ließ der <strong>Evangelische</strong><br />
Oberkirchenrat <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> zu Kriegsbeg<strong>in</strong>n<br />
e<strong>in</strong>en – von ihm selbst entworfenen – kaiserlichen<br />
Erlass von den Kanzeln verlesen, <strong>in</strong> dem<br />
es hieß: „Re<strong>in</strong>en Gewissens über den Ursprung<br />
des Krieges, b<strong>in</strong> ich der Gerechtigkeit unserer Sache<br />
vor Gott gewiß“. 1917 verwies er angesichts<br />
wachsender Resignation auf die Passion Jesu als<br />
FOTOS: ANSICHTKARTENPOOL; EPD (2)<br />
Vorbild für das Durchstehen von Leiden und<br />
machte schließlich die Werbung für Kriegsanleihen<br />
zum pfarramtlichen Auftrag.<br />
Wirkmächtig bis heute s<strong>in</strong>d die Bilder der<br />
Kriegsbegeisterung vom August 1914. Karl Barth<br />
me<strong>in</strong>te damals, <strong>in</strong> <strong>Deutschland</strong> seien „Vaterlandsliebe,<br />
Kriegslust und christlicher Glaube<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong> hoffnungsloses Durche<strong>in</strong>ander“ geraten<br />
und es herrsche e<strong>in</strong>e uniforme „Kriegstheologie“.<br />
Beides lässt sich so nicht halten. Die Kriegsbegeisterung<br />
war weder flächendeckend noch von<br />
der ganzen Bevölkerung getragen. Besonders<br />
flammte sie nach den ersten Siegen auf. Der Leipziger<br />
Pfarrer Georg Liebster schrieb daraufh<strong>in</strong>:<br />
„Jedes Verständnis für Jesus, für Demut, Fe<strong>in</strong>desliebe<br />
ist im religiösen Kriegsfuror erloschen.“<br />
Die Beschwörung des „Geistes von 1914“ <strong>in</strong> der<br />
Folgezeit war dann e<strong>in</strong> Propagandamittel der<br />
Heeresführung gegen nachlassenden Enthusiasmus.<br />
Auch Ernst Troeltsch dichtete zunächst mit<br />
am Mythos „jener unbeschreiblichen E<strong>in</strong>heit des<br />
Opfers, der Brüderlichkeit, des Glaubens und der<br />
Siegesgewißheit“.<br />
Der Hauptstrom kirchlicher Verkündigung<br />
und Verlautbarung bewegte sich <strong>in</strong> den Bahnen<br />
e<strong>in</strong>er nationalkonservativen Geschichtstheologie.<br />
Nach Me<strong>in</strong>ung der führenden deutschen<br />
Intellektuellen verteidigte sich „e<strong>in</strong> Kulturvolk,<br />
dem das Vermächtnis e<strong>in</strong>es Goethe, e<strong>in</strong>es<br />
Beethoven, e<strong>in</strong>es Kant ebenso heilig ist wie se<strong>in</strong><br />
Herd und se<strong>in</strong>e Scholle“, wie es im „Aufruf an die<br />
Kulturwelt“ hieß.<br />
Jedoch: E<strong>in</strong>e „Vere<strong>in</strong>igung von Potsdam und<br />
Bethlehem“ (Friedrich Naumann) konnte aus<br />
politischen wie theologischen Gründen nicht<br />
dauerhaft gel<strong>in</strong>gen. Für Liebster war das Ge- ><br />
80<br />
81