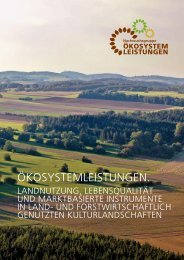Visuelle Modelle - edoc-Server der BBAW - Berlin ...
Visuelle Modelle - edoc-Server der BBAW - Berlin ...
Visuelle Modelle - edoc-Server der BBAW - Berlin ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
60<br />
Samuel Strehle<br />
sich selbst verweist. »Die Archi-Ähnlichkeit ist die ursprüngliche Ähnlichkeit,<br />
jene, die kein Abbild <strong>der</strong> Wirklichkeit liefert, son<strong>der</strong>n unmittelbar von dem An<strong>der</strong>swo,<br />
aus dem sie kommt, zeugt.« 8 Das Bild auf dieser Ebene vertritt kein an<strong>der</strong>es<br />
Ding, son<strong>der</strong>n ist einfach nur als »wortlose Augenscheinlichkeit des Sichtbaren« 9<br />
anwesend vor einem Auge, das ihm seinen Blick schenkt. Doch obgleich wortlos,<br />
signalisiert das Bild zugleich eine eigentümliche Geste <strong>der</strong> Auffor<strong>der</strong>ung, angeschaut<br />
zu werden. »Voici«, 10 spricht es: »Hier, schau her«. Für Rancière ist diese<br />
Selbstbehauptung des Bildes ein »unmittelbarer pathischer Effekt«, 11 ein Effekt<br />
des unmittelbaren Angesprochenseins durch das Gesehene.<br />
Bei <strong>der</strong> Archi-Ähnlichkeit aber bleibt es in aller Regel nicht. Auf einem (gegenständlichen)<br />
Bild nämlich sieht <strong>der</strong> Sehende nicht nur das archi-ähnliche Bildobjekt<br />
allein, son<strong>der</strong>n erkennt im Bild immer auch etwas an<strong>der</strong>es: einen Apfel, einen<br />
Menschen, ein Haus. Dieses Hinausgehen über das Gesehene, die Verknüpfung<br />
des anwesenden Bildobjekts mit einem Abwesenden, das durch das Bild evoziert<br />
wird, führt zur zweiten Stufe des Bildverstehens, <strong>der</strong> Identifikation. Vom Bildobjekt<br />
aus knüpft <strong>der</strong> Sehende ein Band zu einem Vorstellungsbild, das er mit dem<br />
Bildobjekt identifiziert und in eins setzt. Das ganze Geheimnis des Bil<strong>der</strong>sehens<br />
liegt in diesem Vorgang <strong>der</strong> Identifikation begründet. Entsprechend umstritten<br />
war oftmals die genauere Bestimmung dieses entscheidenden Prozesses. Man<br />
kommt aber wohl nicht umhin, die Bedeutung <strong>der</strong> Ähnlichkeit bei dieser Identifikation<br />
anzuerkennen, und sollte Bil<strong>der</strong> auf dieser Ebene nicht als bloß konventionale<br />
Zeichen missverstehen. 12 Die Beson<strong>der</strong>heit <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong> besteht gerade darin,<br />
dass sie das Realobjekt, auf das sie verweisen beziehungsweise dessen Vorstellungsbild<br />
sie evozieren, auch an sich selbst zeigen. An<strong>der</strong>s als das bloße Wort<br />
besitzt das Bild von einem Haus tatsächlich Ähnlichkeit mit einem Haus – ganz<br />
gleich, wie diese Ähnlichkeit im Einzelfall verwirklicht ist, wie ausgeprägt sie ist<br />
und welche an<strong>der</strong>en Faktoren noch in die Zeichenbeziehung mit hinein spielen. 13<br />
Die Identifikation von Bildobjekt und Realobjekt, das »Wie<strong>der</strong>erkennen« 14 ,<br />
geschieht in <strong>der</strong> Regel unwillkürlich und unmittelbar, und zwar umso unwillkürlicher,<br />
je mehr das Bildobjekt dem Realobjekt in wesentlichen Eigenschaften<br />
8 Rancière 2005 (wie Anm. 3), S. 31.<br />
9 Ebd.<br />
10 Ebd., S. 33.<br />
11 Ebd., S. 17.<br />
12 Siehe hierzu auch Klaus Sachs-Hombachs Konzeption des »wahrnehmungsnahen Zeichens«.<br />
Klaus Sachs-Hombach: Das Bild als kommunikatives Medium. Elemente einer allgemeinen<br />
Bildwissenschaft, Köln 2003, S. 88, und den Begriff des »ikonischen Zeichens« bei Charles<br />
S. Peirce: Phänomen und Logik <strong>der</strong> Zeichen [1903], hg. und übers. von Helmut Pape,<br />
Frankfurt am Main 1983, S. 64–67.<br />
13 Für eine »Verteidigung <strong>der</strong> Ähnlichkeitstheorie« siehe Sachs-Hombach 2003 (wie Anm. 12),<br />
S. 129–154.<br />
14 Siehe Ernst H. Gombrich: »<strong>Visuelle</strong> Entdeckungen durch die Kunst«, [1965]. In: <strong>der</strong>s.:<br />
Bild und Auge. Neue Studien zur Psychologie <strong>der</strong> bildlichen Darstellung, [Oxford 1982],<br />
übers. von Lisbeth Gombrich, Stuttgart 1984, S. 11–39; hier S. 12–14.