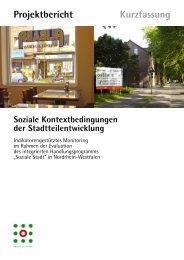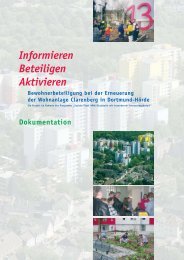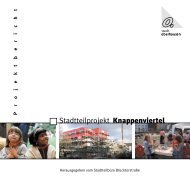Soziale Kontextbedingungen der Stadtteilentwicklung' Langfassung
Soziale Kontextbedingungen der Stadtteilentwicklung' Langfassung
Soziale Kontextbedingungen der Stadtteilentwicklung' Langfassung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. Grundsätze eines indikatorengestützten Monitorings<br />
17<br />
Indikatoren tatsächlich jene sind, die für die oben genannten Funktionen benötigt<br />
werden. Anzustreben ist in jedem Fall ein System von Kontextindikatoren, das<br />
möglichst wenige „fehlende Werte“ aufweist. In unserem Fall gibt es einzelne Programmgebiete,<br />
über die uns eigentlich kaum mehr als nichts mitgeteilt werden<br />
konnte. Es wird also darauf ankommen, die Notwendigkeit und die Brauchbarkeit<br />
aller von uns ausgewerteten Indikatoren noch einmal zu bewerten. Erfor<strong>der</strong>lich ist<br />
auch eine systematische Qualitätsverbesserung und Qualitätskontrolle <strong>der</strong> Kontextindikatoren.<br />
Ein beson<strong>der</strong>es Problem, was die Datenverfügbarkeit und die Datenqualität<br />
angeht, stellen in jedem Fall die kreisangehörigen Gemeinden dar.<br />
Akzeptanz<br />
Auftraggeberin dieser Untersuchung und unsere Vertragspartnerin ist das Städtenetz<br />
„<strong>Soziale</strong> Stadt NRW“. Die Lieferantinnen unserer Daten waren die Mitgliedsstädte<br />
des Städtenetzes. Auftraggeber und „Forschungsobjekte“ sind in<br />
unserem Fall also identisch gewesen. Dennoch hatte unsere Arbeit, vor allem zu<br />
Beginn, unter erheblichen Akzeptanzproblemen zu leiden. Die Mehrzahl <strong>der</strong> Städte<br />
war lediglich bereit, Kontextindikatoren für die Programmgebiete und die Durchschnittswerte<br />
für die Gesamtstadt zu liefern. Ausschlaggebend dafür schien uns<br />
weniger ein Misstrauen gegenüber uns als Wissenschaftlern, son<strong>der</strong>n ein nicht<br />
unproblematisches Verhältnis zwischen den Städten und <strong>der</strong> Landesebene, was<br />
in den meisten Städten dazu führte, mit <strong>der</strong> Weitergabe kleinräumiger Daten, die<br />
nicht zum Pflichtprogramm <strong>der</strong> kommunalen Statistik gehören, eher sparsam zu<br />
verfahren. In einigen Fällen hatten wir auch den Eindruck, dass sich dieses Unbehagen<br />
an <strong>der</strong> „Öffentlichkeit“ von (unter Umständen kompromittierenden) Stadtteilinformationen<br />
auch im Innenverhältnis <strong>der</strong> Städte erkennen ließ.<br />
Angestrebt werden sollte ein solches Maß an Öffentlichkeit, wie es mittlerweile<br />
auch in <strong>der</strong> Bundesrepublik (z.B. im „Wegweiser demographischer Wandel“ <strong>der</strong><br />
Bertelsmann-Stiftung) in diesen Tagen üblich wird und in an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n mittlerweile<br />
Standard ist. Über die Erfahrungen aus dem Ausland, etwa aus den Nie<strong>der</strong>landen<br />
o<strong>der</strong> aus Großbritannien, wo es seit Jahren ein repräsentatives und<br />
öffentliches, alle Stadtteile aller Städte einschließendes Stadtteilmonitoring gibt,<br />
informiert unser Gutachten zu Händen <strong>der</strong> Enquetekommission „Zukunft <strong>der</strong><br />
Städte“ im Landtag von NRW 1 .<br />
Monitoring und „Evaluation“<br />
Unser Projekt „Kontextindikatoren soziale Stadt“ wird zwar im Kontext <strong>der</strong> Evaluation<br />
des Landesprogramms angesiedelt, es erhebt aber explizit nicht den Anspruch,<br />
selbst eine Evaluation <strong>der</strong> Handlungskonzepte in den von und mit den Indikatoren<br />
beschriebenen Programmgebieten vorzunehmen. Ohne hier allzu ausführlich über<br />
Methodologie und Methoden <strong>der</strong> sozialwissenschaftlichen Programmwirkungsanalyse<br />
(Evaluationsforschung) sprechen zu können, sollen dennoch die wesentlichen<br />
Unterschiede in Zielen und Arbeitsweisen unseres Vorgehens mit einer wissenschaftlichen<br />
Evaluation dargestellt werden.<br />
1) ILS NRW – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein<br />
Westfalen (Hrsg.); ZEFIR – Zentrum für interdisziplinäre Ruhrgebietsforschung (Hrsg.) (2003): Sozialraumanalyse<br />
– soziale, ethnische und demografische Segregation in den nordrhein-westfälischen Städten: Gutachten im<br />
Auftrag <strong>der</strong> Enquetekommission „Zukunft <strong>der</strong> Städte in NRW“ des Landtags NRW. Dortmund. – als PDF-Dokument<br />
verfügbar auf <strong>der</strong> Website des Landtags NRW