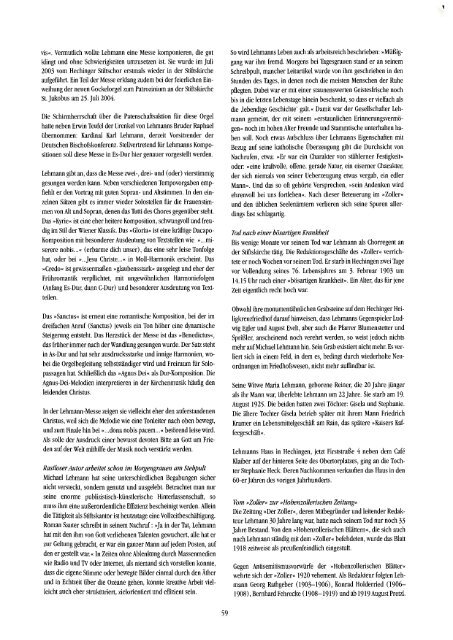Hohenzollerische Heimat - Hohenzollerischer Geschichtsverein eV
Hohenzollerische Heimat - Hohenzollerischer Geschichtsverein eV
Hohenzollerische Heimat - Hohenzollerischer Geschichtsverein eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
vis«. Vermutlich wollte Lehmann eine Messe komponieren, die gut<br />
klingt und ohne Schwierigkeiten umzusetzen ist. Sie wurde im Juli<br />
2003 vom Hechinger Stiftschor erstmals wieder in der Stiftskirche<br />
aufgeführt. Ein Teil der Messe erklang zudem bei der feierlichen Einweihung<br />
der neuen Gockelorgel zum Patrozinium an der Stiftskirche<br />
St. Jakobus am 25- Juli 2004.<br />
Die Schirmherrschaft über die Patenschaftsaktion für diese Orgel<br />
hatte neben Erwin Teufel der Urenkel von Lehmanns Bruder Raphael<br />
übernommen: Kardinal Karl Lehmann, derzeit Vorsitzender der<br />
Deutschen Bischofskonferenz. Stellvertretend für Lehmanns Kompositionen<br />
soll diese Messe in Es-Dur hier genauer vorgestellt werden.<br />
Lehmann gibt an, dass die Messe zwei-, drei- und (oder) vierstimmig<br />
gesungen werden kann. Neben verschiedenen Tempovorgaben empfiehlt<br />
er den Vortrag mit guten Sopran- und Altstimmen. In den einzelnen<br />
Sätzen gibt es immer wieder Solostellen für die Frauenstimmen<br />
von Alt und Sopran, denen das Tutti des Chores gegenüber steht.<br />
Das »Kyrie« ist eine eher heitere Komposition, schwungvoll und freudig<br />
im Stil der Wiener Klassik. Das »Gloria« ist eine kräftige Dacapo-<br />
Komposition mit besonderer Ausdeutung von Textstellen wie »...miserere<br />
nobis...« (erbarme dich unser), das eine sehr leise Tonfolge<br />
hat, oder bei »...Jesu Christe...« in Moll-Harmonik erscheint. Das<br />
»Credo« ist gewissermaßen »glaubensstark« ausgelegt und eher der<br />
Frühromantik verpflichtet, mit ungewöhnlichen Harmoniefolgen<br />
(Anfang Es-Dur, dann C-Dur) und besonderer Ausdeutung von Textteilen.<br />
Das »Sanctus« ist erneut eine romantische Komposition, bei der im<br />
dreifachen Anruf (Sanctus) jeweils ein Ton höher eine dynamische<br />
Steigerung entsteht. Das Herzstück der Messe ist das »Benedictus«,<br />
das früher immer nach der Wandlung gesungen wurde. Der Satz steht<br />
in As-Dur und hat sehr ausdrucksstarke und innige Harmonien, wobei<br />
die Orgelbegleitung selbstständiger wird und Freiraum für Solopassagen<br />
hat. Schließlich das »Agnus Dei« als Dur-Komposition. Die<br />
Agnus-Dei-Melodien interpretieren in der Kirchenmusik häufig den<br />
leidenden Christus.<br />
In der Lehmann-Messe zeigen sie vielleicht eher den auferstandenen<br />
Christus, weil sich die Melodie wie eine Tonleiter nach oben bewegt,<br />
und zum Finale hin bei »...dona nobis pacem...« betörend leise wird.<br />
Als solle der Ausdruck einer bewusst devoten Bitte an Gott um Frieden<br />
auf der Welt mithilfe der Musik noch verstärkt werden.<br />
Rastloser Autor arbeitet schon im Morgengrauen am Stehpult<br />
Michael Lehmann hat seine unterschiedlichen Begabungen sicher<br />
nicht versteckt, sondern genutzt und ausgelebt. Betrachtet man nur<br />
seine enorme publizistisch-künstlerische Hinterlassenschaft, so<br />
muss ihm eine außerordentliche Effizienz bescheinigt werden. Allein<br />
die Tätigkeit als Stiftskantor ist heutzutage eine Vollzeitbeschäftigung.<br />
Roman Sauter schreibt in seinem Nachruf: »Ja in der Tat, Lehmann<br />
hat mit den ihm von Gott verliehenen Talenten gewuchert, alle hat er<br />
zur Geltung gebracht, er war ein ganzer Mann auf jedem Posten, auf<br />
den er gestellt war.« In Zeiten ohne Ablenkung durch Massenmedien<br />
wie Radio und TV oder Internet, als niemand sich vorstellen konnte,<br />
dass die eigene Stimme oder bewegte Bilder einmal durch den Äther<br />
und in Echtzeit über die Ozeane gehen, konnte kreative Arbeit vielleicht<br />
auch eher strukturiert, zielorientiert und effizient sein.<br />
59<br />
So wird Lehmanns Leben auch als arbeitsreich beschrieben: »Müßiggang<br />
war ihm fremd. Morgens bei Tagesgrauen stand er an seinem<br />
Schreibpult, mancher Leitartikel wurde von ihm geschrieben in den<br />
Stunden des Tages, in denen noch die meisten Menschen der Ruhe<br />
pflegten. Dabei war er mit einer staunenswerten Geistesfrische noch<br />
bis in die letzten Lebenstage hinein beschenkt, so dass er vielfach als<br />
die .lebendige Geschichte' galt.« Damit war der Gesellschafter Lehmann<br />
gemeint, der mit seinem »erstaunlichen Erinnerungsvermögen«<br />
noch im hohen Alter Freunde und Stammtische unterhalten haben<br />
soll. Noch etwas Aufschluss über Lehmanns Eigenschaften mit<br />
Bezug auf seine katholische Überzeugung gibt die Durchsicht von<br />
Nachrufen, etwa: »Er war ein Charakter von stählerner Festigkeit«<br />
oder: »eine kraftvolle, offene, gerade Natur, ein eiserner Charakter,<br />
der sich niemals von seiner Ueberzeugung etwas vergab, ein edler<br />
Mann«. Und das so oft gehörte Versprechen, »sein Andenken wird<br />
ehrenvoll bei uns fortleben«. Nach dieser Beteuerung im »Zoller«<br />
und den üblichen Seelenämtern vertieren sich seine Spuren allerdings<br />
fast schlagartig.<br />
Tod nach einer bösartigen Krankheit<br />
Bis wenige Monate vor seinem Tod war Lehmann als Chorregent an<br />
der Stiftskirche tätig. Die Redaktionsgeschäfte des »Zoller« verrichtete<br />
er noch Wochen vor seinem Tod. Er starb in Hechingen zwei Tage<br />
vor Vollendung seines 76. Lebensjahres am 3- Februar 1903 um<br />
14.15 Uhr nach einer »bösartigen Krankheit«. Ein Alter, das für jene<br />
Zeit eigentlich recht hoch war.<br />
Obwohl ihre monumentähnlichen Grabsteine auf dem Hechinger Heiligkreuzfriedhof<br />
darauf hinweisen, dass Lehmanns Gegenspieler Ludwig<br />
Egler und August Evelt, aber auch die Pfarrer Blumenstetter und<br />
Sprißler, anscheinend noch verehrt werden, so weist jedoch nichts<br />
mehr auf Michael Lehmann hin. Sein Grab existiert nicht mehr. Es verliert<br />
sich in einem Feld, in dem es, bedingt durch wiederholte Neuordnungen<br />
im Friedhofswesen, nicht mehr auffindbar ist.<br />
Seine Witwe Maria Lehmann, geborene Reiner, die 20 Jahre jünger<br />
als ihr Mann war, überlebte Lehmann um 22 Jahre. Sie starb am 19.<br />
August 1925. Die beiden hatten zwei Töchter: Gisela und Stephanie.<br />
Die ältere Tochter Gisela betrieb später mit ihrem Mann Friedrich<br />
Kramer ein Lebensmittelgeschäft am Rain, das spätere »Kaisers Kaffeegeschäft«.<br />
Lehmanns Haus in Hechingen, jetzt Firststraße 4 neben dem Café<br />
Klaiber auf der hinteren Seite des Obertorplatzes, ging an die Tochter<br />
Stephanie Heck. Deren Nachkommen verkauften das Haus in den<br />
60-er Jahren des vorigen Jahrhunderts.<br />
Vom »Zoller« zur »<strong>Hohenzollerische</strong>n Zeitung«<br />
Die Zeitung »Der Zoller«, deren Mitbegründer und leitender Redakteur<br />
Lehmann 30 Jahre lang war, hatte nach seinem Tod nur noch 33<br />
Jahre Bestand. Von den »<strong>Hohenzollerische</strong>n Blättern«, die sich auch<br />
nach Lehmann ständig mit dem »Zoller« befehdeten, wurde das Blatt<br />
1918 zeitweise als preußenfeindlich eingestuft.<br />
Gegen Antisemitismusvorwürfe der »<strong>Hohenzollerische</strong>n Blätter«<br />
wehrte sich der »Zoller« 1920 vehement. Als Redakteur folgten Lehmann<br />
Georg Rathgeber (1903-1906), Konrad Holderried (1906-<br />
1908), Bernhard Fehrecke (1908-1919) und ab 1919 August Pretzl.<br />
1