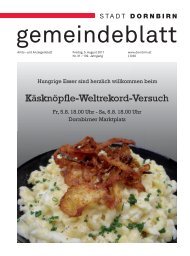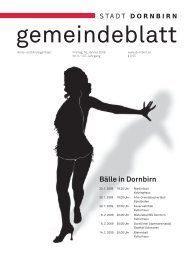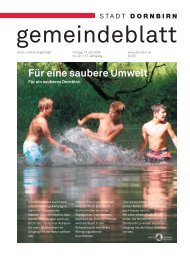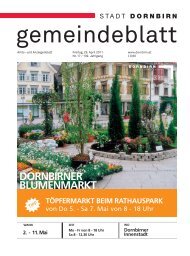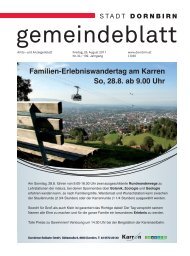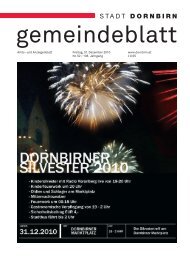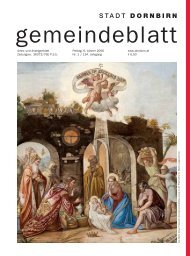CITY GUIDE DORNBIRN RITUALE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DIE BAUERNSTADT<br />
<strong>DORNBIRN</strong><br />
Rituale und vergessenes Brauchtum: Dornbirn ist nicht nur die größte Stadt sondern auch die<br />
größte Landwirtschaftsgemeinde Vorarlbergs: Von ihren über 12.000 Hektar Stadtfläche sind<br />
87 Prozent grün: Wald (4.800 ha), Wiesen, Weiden und Alpen (5.700 ha). Die „Bauernstadt“ ist<br />
historisch gewachsen. Dornbirns Dörfer schlossen sich erst 1901 zur Stadt zusammen. Auch<br />
wer „in der Stadt“ lebte, hatte früher seinen Hof, sein Vieh und seinen Acker oder die Wiese.<br />
Selbst die hochlöblichen Fabrikanten waren großteils Landwirte mit viel Grund, Vieh und Pferden.<br />
Die Alltagsrituale der Menschen waren einerseits geprägt von den Produktionsbedingungen<br />
der Landwirtschaft und andererseits von den Anlässen des Kirchenjahres. Inzwischen sind<br />
viele der alten Bräuche in Vergessenheit geraten, manches wird touristisch oder im Zuge des<br />
Esoterik-Booms wiederbelebt, nur vereinzelt werden noch alte Rituale gepflegt.<br />
Buschla: Das sorgfältige Zusammenlegen<br />
und Binden von dürren, dünnen<br />
Ästen und Zweigen, zu Bündeln, die im<br />
Kachelofen verfeuert wurden. Schöne Buscheln<br />
zu machen, geriet oft zum Ritual.<br />
Funkensonntag: Am Sonntag<br />
nach Aschermittwoch wird im alemannischen<br />
Raum der Winter mit einem großen<br />
Feuer beendet und damit der Frühling eingeleitet.<br />
Hochzeit: Bei den Verehelichungen<br />
bestand der Brauch, dass Jugendliche<br />
den Brautwagen anhielten, wobei die Hochzeiter<br />
einiges über sich ergehen lassen<br />
mussten. Zumeist hatten sie Getränke zu<br />
spendieren oder sonst eine Gebühr zu entrichten.<br />
Die Feier im Anschluss daran nannte<br />
man „braudtwagen auf hebungs zerig“;<br />
manchmal heißt es auch, man habe den<br />
Brautwagenwein „vertrunken“. Übernahm<br />
ein Sohn oder Schwiegersohn den Besitz,<br />
hatte er die Mutter oder Schwiegermutter<br />
ordentlich „auszusteuern“, das heißt ihre<br />
Versorgung zu garantieren. Dabei mussten<br />
die dazu erforderlichen Sachgüter traditionsgemäß<br />
in einer „Aussteuertruhe“ ausgehändigt<br />
werden.<br />
Türggabrätscha: Einst wurden<br />
die Äcker in der Dornbirner Ebene noch in<br />
strikter Wechselwirtschaft mit Riebelmais<br />
(„Türgga“) bebaut, dem neben der Kartoffel<br />
wichtigsten Rohstoff für die Ernährung<br />
der Bevölkerung. Zur Erntezeit zog man in<br />
Gruppen von Hof zu Hof, saß in geselliger<br />
Runde zusammen und schälte gemeinsam<br />
die Maiskolben bis auf drei Blätter („Brätscha“),<br />
verknüpfte zwei und zwei solchermaßen<br />
geschälte Kolben und hängte sie auf<br />
ein Dreiecksgestell zum Trocknen auf. Dazu<br />
wurde auch gesungen und musiziert.<br />
Landsredling: Einen Brauch, der<br />
an keine bestimmten Termine im Jahr gebunden<br />
war, bildete das „Landsredling“,<br />
das in den Akten zwischen 1704 und 1769<br />
belegt ist. Dabei handelte es sich um einen<br />
Notfeuerbrauch, welcher der Verhinderung<br />
oder Bekämpfung von Viehkrankheiten<br />
diente. Zunächst wurde in eingezäunten<br />
Viehtriften oder in Hohlwegen mühsam ein<br />
Feuer entfacht, woher das Bestimmungswort<br />
„Not-“ herrühren soll. Anschließend<br />
trieb man die Tiere, die nicht ausbrechen<br />
konnten, zumeist dreimal mit Gewalt durchs<br />
Feuer, um sie dadurch von Krankheiten zu<br />
reinigen bzw. gegen diese gefeit zu machen.<br />
Sowohl Feuer als auch Glut und Asche galten<br />
in verschiedener Weise als heilkräftig.<br />
Weihnachten, Advent: Geschenke<br />
wurden ursprünglich nicht am Heiligen<br />
Abend, sondern am Nikolausabend verteilt.<br />
In diesem Rahmen ging es aber nicht immer<br />
beschaulich her. Es kam regelmäßig zu „unfugen<br />
mit verklaidung der burger, nächtlichen<br />
tumulten, erschrecken der kinder“.<br />
Aufgrund etlicher Raufereien ist auch überliefert,<br />
dass um die Jahreswende die so genandte<br />
„laible nacht“ oder „ordinari laible<br />
nacht“ gefeiert wurde. Dabei dürfte es sich<br />
um einen Heischebrauch im Rahmen der<br />
so genannten Rauh- oder Gebnächte zwischen<br />
Weihnachten und dem Dreikönigstag<br />
gehandelt haben. Weniger archaisch wirkt<br />
die Aufstellung eines weihnachtlichen „kripelin“<br />
in der Kirche. Sie lässt sich in Dornbirn<br />
1721 das erste Mal nachweisen.<br />
Wetterläuten: Im Zusammenhang<br />
mit Hagel und Gewittern zählte das Wetterläuten<br />
zu einer der wichtigsten Aufgaben<br />
der Mesner. Durch den Klang der geweihten<br />
Glocken sollten die bösen Mächte, die<br />
in den Wolken drohten, vertrieben werden.<br />
Deshalb läutete man vielerorts auch in der<br />
Nacht vom 30. April auf den ersten Mai, in<br />
der berüchtigten Walpurgisnacht. Nach<br />
altem Glauben fuhren an diesem ihrem<br />
Hauptfest die Hexen aus und verfügten dabei<br />
über die höchste Macht.<br />
Siehe dazu auch: Manfred Tschaikner auf<br />
http://lexikon.dornbirn.at<br />
Literatur: TSCHAIKNER Manfred:<br />
Dornbirn in der frühen Neuzeit.<br />
In: Werner Matt, Hanno Platzgummer (Hrsg.):<br />
Geschichte der Stadt Dornbirn. Band 1, 2002<br />
67