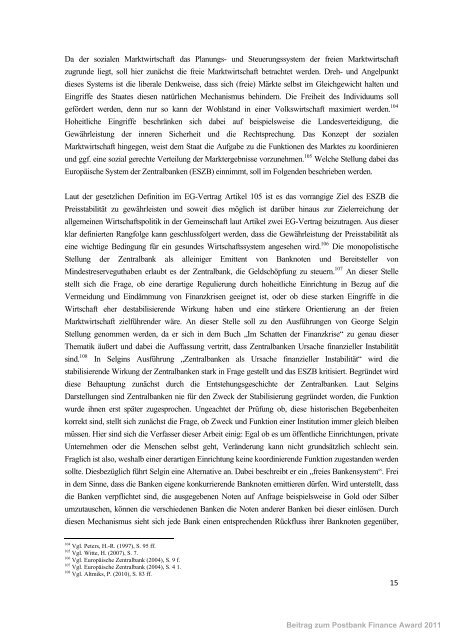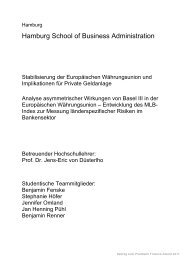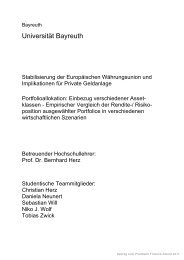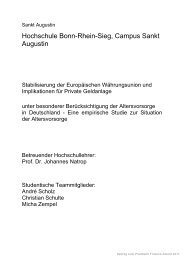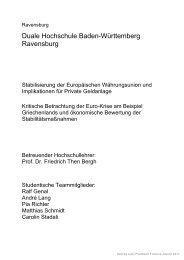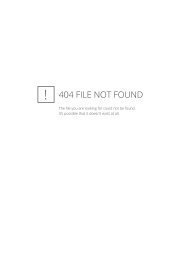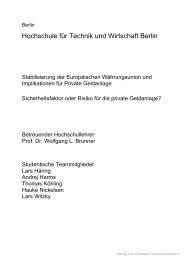The SAME procedure as every crisis: Die vier ... - Die Welt
The SAME procedure as every crisis: Die vier ... - Die Welt
The SAME procedure as every crisis: Die vier ... - Die Welt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Da der sozialen Marktwirtschaft d<strong>as</strong> Planungs- und Steuerungssystem der freien Marktwirtschaft<br />
zugrunde liegt, soll hier zunächst die freie Marktwirtschaft betrachtet werden. Dreh- und Angelpunkt<br />
dieses Systems ist die liberale Denkweise, d<strong>as</strong>s sich (freie) Märkte selbst im Gleichgewicht halten und<br />
Eingriffe des Staates diesen natürlichen Mechanismus behindern. <strong>Die</strong> Freiheit des Individuums soll<br />
gefördert werden, denn nur so kann der Wohlstand in einer Volkswirtschaft maximiert werden. 104<br />
Hoheitliche Eingriffe beschränken sich dabei auf beispielsweise die Landesverteidigung, die<br />
Gewährleistung der inneren Sicherheit und die Rechtsprechung. D<strong>as</strong> Konzept der sozialen<br />
Marktwirtschaft hingegen, weist dem Staat die Aufgabe zu die Funktionen des Marktes zu koordinieren<br />
und ggf. eine sozial gerechte Verteilung der Marktergebnisse vorzunehmen. 105 Welche Stellung dabei d<strong>as</strong><br />
Europäische System der Zentralbanken (ESZB) einnimmt, soll im Folgenden beschrieben werden.<br />
Laut der gesetzlichen Definition im EG-Vertrag Artikel 105 ist es d<strong>as</strong> vorrangige Ziel des ESZB die<br />
Preisstabilität zu gewährleisten und soweit dies möglich ist darüber hinaus zur Zielerreichung der<br />
allgemeinen Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft laut Artikel zwei EG-Vertrag beizutragen. Aus dieser<br />
klar definierten Rangfolge kann geschlussfolgert werden, d<strong>as</strong>s die Gewährleistung der Preisstabilität als<br />
eine wichtige Bedingung für ein gesundes Wirtschaftssystem angesehen wird. 106 <strong>Die</strong> monopolistische<br />
Stellung der Zentralbank als alleiniger Emittent von Banknoten und Bereitsteller von<br />
Mindestreserveguthaben erlaubt es der Zentralbank, die Geldschöpfung zu steuern. 107 An dieser Stelle<br />
stellt sich die Frage, ob eine derartige Regulierung durch hoheitliche Einrichtung in Bezug auf die<br />
Vermeidung und Eindämmung von Finanzkrisen geeignet ist, oder ob diese starken Eingriffe in die<br />
Wirtschaft eher destabilisierende Wirkung haben und eine stärkere Orientierung an der freien<br />
Marktwirtschaft zielführender wäre. An dieser Stelle soll zu den Ausführungen von George Selgin<br />
Stellung genommen werden, da er sich in dem Buch „Im Schatten der Finanzkrise“ zu genau dieser<br />
<strong>The</strong>matik äußert und dabei die Auff<strong>as</strong>sung vertritt, d<strong>as</strong>s Zentralbanken Ursache finanzieller Instabilität<br />
sind. 108 In Selgins Ausführung „Zentralbanken als Ursache finanzieller Instabilität“ wird die<br />
stabilisierende Wirkung der Zentralbanken stark in Frage gestellt und d<strong>as</strong> ESZB kritisiert. Begründet wird<br />
diese Behauptung zunächst durch die Entstehungsgeschichte der Zentralbanken. Laut Selgins<br />
Darstellungen sind Zentralbanken nie für den Zweck der Stabilisierung gegründet worden, die Funktion<br />
wurde ihnen erst später zugesprochen. Ungeachtet der Prüfung ob, diese historischen Begebenheiten<br />
korrekt sind, stellt sich zunächst die Frage, ob Zweck und Funktion einer Institution immer gleich bleiben<br />
müssen. Hier sind sich die Verf<strong>as</strong>ser dieser Arbeit einig: Egal ob es um öffentliche Einrichtungen, private<br />
Unternehmen oder die Menschen selbst geht, Veränderung kann nicht grundsätzlich schlecht sein.<br />
Fraglich ist also, weshalb einer derartigen Einrichtung keine koordinierende Funktion zugestanden werden<br />
sollte. <strong>Die</strong>sbezüglich führt Selgin eine Alternative an. Dabei beschreibt er ein „freies Bankensystem“. Frei<br />
in dem Sinne, d<strong>as</strong>s die Banken eigene konkurrierende Banknoten emittieren dürfen. Wird unterstellt, d<strong>as</strong>s<br />
die Banken verpflichtet sind, die ausgegebenen Noten auf Anfrage beispielsweise in Gold oder Silber<br />
umzutauschen, können die verschiedenen Banken die Noten anderer Banken bei dieser einlösen. Durch<br />
diesen Mechanismus sieht sich jede Bank einen entsprechenden Rückfluss ihrer Banknoten gegenüber,<br />
104 Vgl. Peters, H.-R. (1997), S. 95 ff.<br />
105 Vgl. Witte, H. (2007), S. 7.<br />
106 Vgl. Europäische Zentralbank (2004), S. 9 f.<br />
107 Vgl. Europäische Zentralbank (2004), S. 4 1.<br />
108 Vgl. Altmiks, P. (2010), S. 83 ff.<br />
15<br />
Beitrag zum Postbank Finance Award 2011