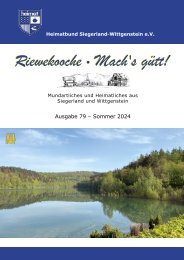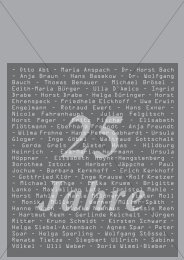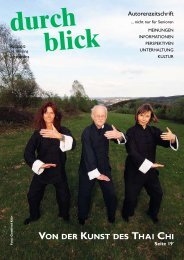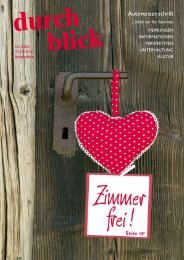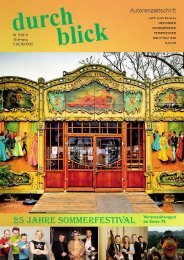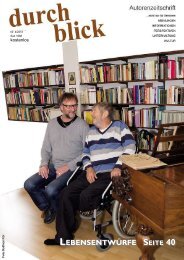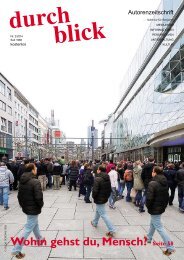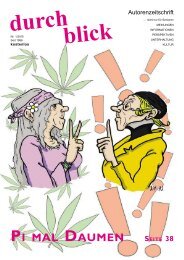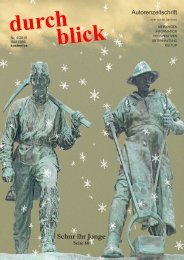Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Unterhaltung<br />
bzw. „Düngung“. Nicht erwähnt wird im Siegerländer Wörterbuch,<br />
dass schon im Althochdeutschen (750 bis 1050)<br />
die Düngung „tunga“ hieß und dass man anstatt düngen<br />
„tungen“ sagte.<br />
Was aber hat die Düngung mit unserer Dong zu tun?<br />
Im mittelhochdeutschen Wörterbuch von Matthias Lexer<br />
steht, dass man das Wort „tungen“ (auch „dungen“ und<br />
„tongen“ geschrieben) bildlich damals<br />
auch für Stärkung bzw. Erquickung<br />
nutzte. Beispiele hierzu sind: „daz ist<br />
sines herzen tunge“ oder „daz leben wirt<br />
getunget“. Heinzerling/Reuter schreiben<br />
dann auch: „... das Wort hat siegerländisch<br />
nicht mehr die ursprünglichere,<br />
im hochdeutschen ‚Dünger‘ erhaltene<br />
Bedeutung. Das mittelhochdeutsche<br />
tunge ... hat ... eine bildliche Bedeutung<br />
‚Stärkung‘, ‚Erfrischung‘ entwickelt,<br />
welche die siegerländische Bedeutung,<br />
eigentlich ‚Düngung des Butterbrotes‘,<br />
erklärlich macht. Die ‚Düngung‘, der<br />
erfrischende saftige Brotaufstrich, dient<br />
dann zur Bezeichnung des Butterbrots<br />
selbst.“<br />
Auch wenn der Ursprung des Wortes<br />
„Dong“ für unsere heutigen Begriffe<br />
etwas „anrüchig“ daher kommt, muss<br />
man die im Siegerländer Wörterbuch<br />
gefundene Erklärung (die zudem durch<br />
die mittel- und althochdeutschen Wörterbücher<br />
gefestigt wird) als die einzig<br />
richtige ansehen. Lassen Sie sich Ihre<br />
stärkende und erfrischende Dong heute<br />
Abend oder morgen früh recht gut<br />
schmecken!<br />
Ulli Weber<br />
Dengong<br />
em Fre’joar<br />
Mier mochen emo en de<br />
earschde Abre’lldache en<br />
Sondachsnommedachs-<br />
Schbazi’ergang. Drai Schdonn sin m’r om<br />
“Kulmerich” en Frairebearch remgelaufe,<br />
ha det schea geärerde Haubearchsholz<br />
bewonnert, konnen de Schbazi’ergängrer,<br />
di os begänden, a de Fengern afzealn on<br />
ha fergäwens fersocht, de Fejjelche piffe<br />
ze hearn.<br />
Arich kalt woaret! Niks, awer och gar<br />
niks hoarde m’r. Aimo e bessje Gegnisder<br />
em Onnerholz. Zwai Rehe gräjen m’r<br />
ze se’ on en Has hebbde schwinn foar’da.<br />
A d’r Nordsitte log noch schnaisewis d’r<br />
Schne wo fresch geschrabbt, on en denne Isdecke zog sech<br />
gletzerich gre ewer d’r Önnerwäjjer.<br />
Om Haimwäch, oawerhalb fam Frailechtdreja’der sogen<br />
m’r fa wierem of d’r Schdrose wat läjje. A däm, wat do log,<br />
komen mier foarbi. Ech säde: „Dä Hebbel he kenn ech got<br />
foar de Blome br’uche“, d’rbi guckde ech so e bessje schäb<br />
fa onnerof zo d’m Minne hin. „Ech ha noch so en Perlondudde<br />
bi m’r, ob ech m’r fa däm do, wat do läjjt, wat doren<br />
do? Wat mainsde?<br />
Sall ech?“<br />
„Frou! Dat<br />
aine well ech<br />
d’r sä“, blarrde<br />
hä mech glich a,<br />
„ewerall kasde<br />
d’r de Peardsäbbel<br />
foar de<br />
Blome hoaln,<br />
nuer net ho on<br />
fa he oawe on<br />
da och noch en<br />
so ner duerchsechdije<br />
Dudde<br />
duerch d’r ,Ale<br />
Fläcke‘ schläbbe.<br />
On mech!“<br />
De Fre’joars<br />
dengong ha m’r<br />
da lenks läjje<br />
loase on sin d’r<br />
one duerch d’r<br />
„Ale Fläcke“<br />
nohaim gange.<br />
Gerda Greis<br />
durchblick 1/<strong>2009</strong> 27