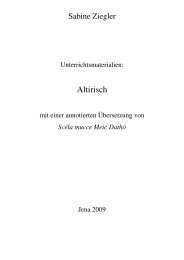Einführng in das Altsächsische
Einführng in das Altsächsische
Einführng in das Altsächsische
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
8 <strong>E<strong>in</strong>führng</strong> <strong>in</strong> <strong>das</strong> <strong>Altsächsische</strong><br />
Diözesen, die unter Karl dem Grossen e<strong>in</strong>gerichtet wurden: Osnabrück (772/853), Bremen<br />
(787), Verden (788); Paderborn (795), M<strong>in</strong>den (803), Hambrug (804/831), Münster (805),<br />
Halberstadt (814), Hildesheim (814).<br />
o Außer diesen sächsischen Bistümern hatten auf die Bekehrung der Sachsen und die<br />
Aufzeichnung der für die Bekehrung zu verwertenden Schriften die Abtei von Fulda<br />
und <strong>das</strong> Erzbistum Ma<strong>in</strong>z, erstere hauptsächlich <strong>in</strong> Engern, letzteres <strong>in</strong> Nord-Thür<strong>in</strong>gen<br />
sowie <strong>in</strong> den Bistümern Halberstadt und Hildesheim. Der südwestliche Teil blieb als<br />
altbekehrtes Gebiet unter dem Erzbistum Köln.<br />
� Das As. wird bei der dialektalen Gliederung des Germanischen <strong>in</strong> der Regel <strong>in</strong>nerhalb des<br />
Westgermanischen zu dem Friesischen und Englischen (ebenfalls zum Niederländischen<br />
[Niederfränkischen]) gestellt, und zwar aufgrund zweier wichtiger Übere<strong>in</strong>stimmungen:<br />
o Ausfall der Nasale m und n vor den Spiranten f, s und þ (vgl. fīf ‚fünf‘; ūs ‚uns‘; kūđ<br />
‚kund‘);<br />
o Zusammenfall der drei Personen des Plurals aller Tempora und Modi des Verbs <strong>in</strong> je<br />
e<strong>in</strong>e Form (vgl. <strong>in</strong>d.präs. b<strong>in</strong>dad ‚ihr b<strong>in</strong>det, wir/sie b<strong>in</strong>den‘, bundun ‚ihr bandet, wir/sie<br />
banden‘).<br />
o Andererseits darf jedoch nicht übersehen werden, <strong>das</strong>s <strong>das</strong> As. <strong>in</strong> manchen Punkten<br />
(etwa <strong>in</strong> Bezug auf die Entwicklung der Vokale <strong>in</strong> den Endsilben) dem Ahd. näher steht.<br />
Aus diesem Grund wird <strong>das</strong> As. teils e<strong>in</strong>e Mischsprache genannt.<br />
o Gegen diese Auffassung wurde neuerd<strong>in</strong>gs von Krogh, Steffen, Die Stellung des<br />
<strong>Altsächsische</strong>n im Rahmen der germanischen Sprachen, Gött<strong>in</strong>gen 1996 E<strong>in</strong>wand<br />
erhoben. Er sieht <strong>in</strong> <strong>das</strong> As. e<strong>in</strong>en völlig separaten Zweig des Westgermanischen. In<br />
dieser Str<strong>in</strong>genz sche<strong>in</strong>t se<strong>in</strong>e Position jedoch kaum haltbar zu se<strong>in</strong>.<br />
1.2. Die Quellen des <strong>Altsächsische</strong>n<br />
� Die <strong>in</strong> as. Sprache geschriebenen Denkmäler entstammen der Zeit vom 9. bis 12. Jh. Die<br />
Quellen bestehen – abgesehen von Personen- und Ortsnamen – aus erstens zwei größeren<br />
Dichtungen und zweitens den so genannten kle<strong>in</strong>eren Denkmälern, die wiederum <strong>in</strong><br />
zusammenhängenden poetischen und prosaischen Texten, Interl<strong>in</strong>earversionen und