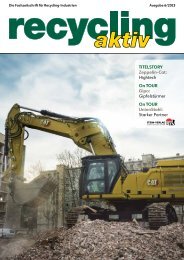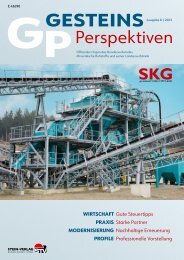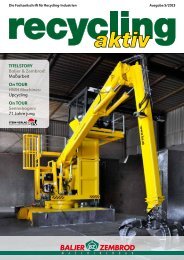GesteinsPerspektiven 01/22
Die GP GesteinsPerspektiven ist offizielles Organ des Bundesverbandes Mineralische Rohstoffe e.V. (MIRO). Thematische Schwerpunkte sind Fachartikel, Berichte und Reportagen. Folgende Bereiche werden publizistisch abgedeckt: Wirtschaft, Politik und Recht mit Auswirkungen auf die Roh- und Baustoffindustrie, Prospektion, Lagerstättenerkundung, Lagerstättenbewertung, Betriebsplanung und Abbautechnik, Gewinnung und Verarbeitung mineralischer Rohstoffe, Aufbereitung: Zerkleinerung, Klassierung, Sortierung, Materialreinigung, Veredelung: Transportbeton, Asphalt, Wiedernutzbarmachung durch Rekultivierung und/oder Renaturierung, Genehmigungsverfahren und Genehmigungspraxis, Forschung sowie Aus- und Weiterbildung.
Die GP GesteinsPerspektiven ist offizielles Organ des Bundesverbandes Mineralische Rohstoffe e.V. (MIRO). Thematische Schwerpunkte sind Fachartikel, Berichte und Reportagen. Folgende Bereiche werden publizistisch abgedeckt: Wirtschaft, Politik und Recht mit Auswirkungen auf die Roh- und Baustoffindustrie, Prospektion, Lagerstättenerkundung, Lagerstättenbewertung, Betriebsplanung und Abbautechnik, Gewinnung und Verarbeitung mineralischer Rohstoffe, Aufbereitung: Zerkleinerung, Klassierung, Sortierung, Materialreinigung, Veredelung: Transportbeton, Asphalt, Wiedernutzbarmachung durch Rekultivierung und/oder Renaturierung, Genehmigungsverfahren und Genehmigungspraxis, Forschung sowie Aus- und Weiterbildung.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
WORKSHOPREIHE A: Die Blocküberschriften „Mineralische Rohstoffgewinnung<br />
und CO 2 -Diskussion“, „Zukunftsträchtige Energien: Erzeugung, Pufferung<br />
und Lastausgleich in Einklang bringen“ sowie „Regionale Rohstoffgewinnung:<br />
Ein Beitrag zum Klimaschutz“ bildeten das Dach über den interessanten<br />
Vorträgen. Sie zeigten, dass die Branche den Anschluss an Zukunftsthemen<br />
nicht erst mühsam suchen muss, sondern längst hat.<br />
Zielsetzung für klimafreundliche Ausschreibungen und das<br />
Vergaberecht transparenter zu machen. Dem in der Ankündigung<br />
ziemlich klaren Ansinnen gingen allerdings eine umfängliche<br />
Selbstvorstellung des Switch von der früheren<br />
Zuständigkeit auf das jetzige Unternehmen sowie eine Vorstellung<br />
verschiedener Bauweisen und Regelwerke voraus.<br />
Die eigentliche Antwort lautet knapp: Zielsetzung für die klimafreundliche<br />
Ausschreibung und Vergabe ist eine aktuelle<br />
Auflistung regionaler Rohstoff-Lieferanten sowie eine Reduzierung<br />
des CO 2 -Fußabdrucks – was man auch „kurze Lieferwege“<br />
nennen kann. Hinzu kommen eine umweltschonende<br />
Gewinnung, der Einsatz von RC-Material (Asphalt/Beton)<br />
und definierte Lieferbedingungen (gemäß FGSV). Außerdem<br />
sollen Leistungsbeschreibungen angepasst und Vorgaben<br />
verschärft werden. Letzteres dürfte spannend werden, speziell<br />
in der nächsten Zeit.<br />
Nachnutzung unter neuen Vorzeichen<br />
An das Bundesumweltministerium richteten sich die Fragen<br />
„Was ‚wünscht‘ sich der Naturschutz – auch unter Berücksichtigung<br />
von ‚Natur auf Zeit‘?“, und: „Welche Folgenutzungen<br />
gilt es unter Klimaaspekten neu zu denken?“.<br />
Bekannte Nachnutzungskonzepte üblicher Art kommen<br />
demnach auch in Zukunft nicht aus der Mode; in Bezug auf<br />
Natur- und Klimaschutz erhalten natürliche Sukzession, Renaturierung,<br />
naturnahe Gestaltung, Wiedernutzbarmachung<br />
durch Aufforstung und die damit verbundene CO 2 -Speicherung<br />
möglicherweise den Vorzug. Aufgrund der langen Zeitspanne<br />
zwischen Genehmigung und Nachnutzung sei aber<br />
auch eine dynamische Interpretation von Nachnutzungsverpflichtungen<br />
von Bedeutung, um vielfältige und klimaresistente<br />
Lebensräume zu generieren. Beim Thema „Natur auf Zeit“<br />
tritt nun wohl angesichts der passenden Pflöcke im Insektenschutzgesetz<br />
und der nachgewiesenen Erfolge ein erfreulicher<br />
Wandel ein, der zur Anerkennung sowie Entwicklung des Themas<br />
führt. Vorschläge aus einem F&E-Vorhaben des Bundesamtes<br />
für Naturschutz wie: „mehr Auslegungsspielraum im<br />
Rahmen von § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG“, „Ausnahmeerteilung<br />
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG“ sowie die Orientierung an Umsetzungsbeispielen<br />
bringen die Möglichkeiten voran. Auch der<br />
bayerische Ansatz der Vorabausnahme muss kein Exot bleiben,<br />
da die 2021 überarbeitete Fassung des EU-Kommissions-Leitfadens<br />
zum strengen Schutzsystem für Tierarten von<br />
gemeinschaftlichem Interesse einen neuen Abschnitt zu<br />
„Natur auf Zeit“ beinhaltet und die Erteilung von Vorabausnahmen<br />
in bestimmten Fällen anerkennt. Weitere neu angedachte<br />
und zugunsten von „NaZ“ formulierte Vorschriften im<br />
BNatSchG wurden aufgeführt. Ein Lichtblick, an dem die Beharrlichkeit<br />
der MIRO-Arbeit einen wichtigen Anteil hat.<br />
Die richtigen Bäume und Sträucher bei sich änderndem<br />
Klima für optimale forstliche Rekultivierungen auszuwählen,<br />
ist Teil des Erfolgs der Maßnahme unter sich möglicherweise<br />
ändernden Bedingungen. Das Institut für Waldbau der TU<br />
Dresden empfiehlt dafür eine Diversifizierung, sprich: bei den<br />
Baumarten und Sträuchern sollten alle ökologischen Charaktere<br />
in Mischbeständen einbezogen werden. Schluss-, Intermediär-<br />
und Pionierarten, Baumarten mit weiter ökologischer<br />
Amplitude ebenso wie Spezialisten bedeuten eine Risikostreuung,<br />
um auch unter neuen klimatischen Bedingungen Waldstrukturen<br />
zu schaffen. Erläutert wurden in diesem Zusam-<br />
GESTEINS Perspektiven 1 | 20<strong>22</strong>