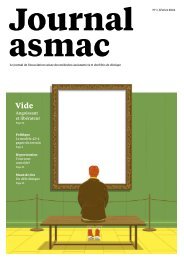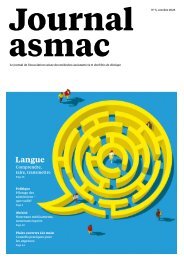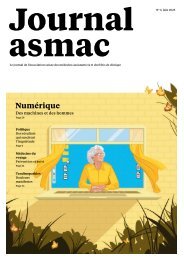vsao Journal Nr. 5 - Oktober 2023
Sprache - Verstehen, verstummen, vermitteln Politik - Zulassungssteuerung – quo vadis? Adipositas - Neue Medikamente wecken Hoffnungen Offene Handverletzungen - Tipps und Tricks für den Notfall
Sprache - Verstehen, verstummen, vermitteln
Politik - Zulassungssteuerung – quo vadis?
Adipositas - Neue Medikamente wecken Hoffnungen
Offene Handverletzungen - Tipps und Tricks für den Notfall
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fokus: Sprache<br />
Bild: © Karl-Ludwig Wetzig, zvg<br />
Sie sind Spezialist für skandinavische<br />
Sprachen und übersetzen vor allem<br />
aus dem Isländischen ins Deutsche.<br />
Was tun Sie mit Wörtern, die sich nicht<br />
übersetzen lassen?<br />
Manche Wörter erscheinen als unübersetzbar,<br />
weil mit ihnen Dinge bezeichnet<br />
werden, die in der Zielkultur nicht vorhanden<br />
sind. Solche Wörter kann ich umschreiben,<br />
erklären, ihre Wortbestandteile<br />
übersetzen und so ein neues deutsches<br />
Wort kreieren oder sie als Fremdwörter<br />
übernehmen, um die Fremdartigkeit hervorzuheben.<br />
Und manchmal integrieren<br />
wir solche Wörter in unsere eigene Sprache:<br />
Nehmen Sie nur Geysir, ein isländisches<br />
Wort, das heute überall auf der Welt<br />
für heisse Springquellen verwendet wird.<br />
Und vor zehn Jahren hätte ich noch überlegt,<br />
den isländischen Skyr vielleicht mit<br />
«Sauerquark» zu übersetzen; heute steht<br />
er bei uns im Supermarkt. Probleme mit<br />
vermeintlicher Unübersetzbarkeit sehe<br />
ich daher weniger auf der Wortebene, sondern<br />
mehr auf den übergeordneten und<br />
umfassenderen Ebenen von Satz, Text,<br />
Konnotationen und soziokulturellem<br />
Hintergrund.<br />
Haben Sie Beispiele für solche<br />
Herausforderungen?<br />
Zwei verschiedene Sprachen sind niemals<br />
völlig gleich strukturiert. Das Isländische<br />
ist nicht so auf Präzision und Eindeutigkeit<br />
der Bezüge versessen wie das Deutsche.<br />
Zwei Beispiele: Das Isländische kann<br />
Verwandtschaftsgrade begrifflich bis in<br />
den fünften Grad differenzieren. Im Alltag<br />
bezeichnet man Verwandte, die nicht Eltern<br />
oder Geschwister sind, allerdings<br />
meist lediglich als frændi beziehungsweise<br />
frænka. In der Übersetzung muss ich<br />
differenzieren, ob es sich dabei um Onkel<br />
oder Cousins respektive Tanten oder<br />
Cousinen handelt, obwohl der Ausgangstext<br />
da unbestimmt bleibt. Und wenn ein<br />
isländisches Personalpronomen im Singular<br />
und Plural dieselbe Form aufweist, darf<br />
durchaus offenbleiben, ob es für eine oder<br />
mehrere Personen steht. Nicht so in der<br />
Übersetzung. Eindeutigkeit herzustellen,<br />
wo die Ausgangssprache mehrere Deutungsmöglichkeiten<br />
zulässt, stellt für<br />
mich eine Einschränkung und letztlich<br />
Verarmung des literarischen Potenzials<br />
dar, gegen die ich mich sträube. Denn<br />
Mehrdeutigkeit ist doch eine der produktivsten<br />
Qualitäten von Literatur. Weiter<br />
sollte ich als Übersetzer nicht bloss die<br />
Zielsprache gut kennen, sondern auch die<br />
Kultur und Gesellschaft, in die sie eingebettet<br />
ist. Nehmen Sie nur die schlichte<br />
Aussage aus der Bibel: «Siehe, ich stehe<br />
vor der Tür und klopfe an.» Und dann malen<br />
Sie sich die Wirkung aus, wenn ein<br />
Missionar diesen Vers wörtlich in eine<br />
Sprache Afrikas übersetzt hätte, wo niemand<br />
anklopft ausser Einbrecher, die testen<br />
wollen, ob jemand im Haus ist … Wortwörtliche<br />
Übersetzungen können fatale<br />
Folgen haben.<br />
Wie gehen Sie bei einer Übersetzung<br />
konkret vor?<br />
Selbstverständlich lese ich den Ausgangstext<br />
zuerst einmal möglichst gründlich<br />
und analytisch durch. Wenn Handlung<br />
oder Personenkonstellationen besonders<br />
kompliziert sind, erstelle ich Stammbäume<br />
oder Soziogramme der handelnden<br />
Personen, um den Überblick zu behalten.<br />
Bei anspruchsvollen Texten wie etwa den<br />
Isländersagas führe ich eine Art Arbeitsjournal,<br />
in dem ich beispielsweise einzelne<br />
Übersetzungslösungen notiere und<br />
begründe für den Fall, dass die gleiche<br />
Vokabel später noch einmal auftauchen<br />
sollte. Seit es das Internet gibt, recherchiere<br />
ich Dinge immer gleich dann, wenn<br />
eine Schwierigkeit im Text auftaucht,<br />
denn ich möchte am liebsten gleich eine<br />
gültige Übersetzungslösung finden und<br />
nicht im Nachgang vor einem Wust ungeklärter<br />
Textstellen stehen. Den Vorgang<br />
des Übersetzens selbst können Sie sich bei<br />
mir als eine Kette zahlloser Re-Lektüren<br />
vorstellen: Jeder Arbeitstag beginnt damit,<br />
dass ich mir das am Vortag Übersetzte<br />
noch einmal genau ansehe, bevor ich das<br />
nächste Kapitel in Angriff nehme. Nach<br />
dem Feinschliff lektoriert der Verlag die<br />
Übersetzung und ich überlege an jeder<br />
einzelnen Stelle, ob ich den Änderungsvorschlag<br />
des Lektorats übernehme, meine<br />
ursprüngliche Übersetzung doch passender<br />
finde oder nach einer dritten Möglichkeit<br />
suche. Nach einer letzten Prüfung<br />
der Druckfahnen erteile ich dem scheinbar<br />
fertigen Text das Imprimatur. Ich sage<br />
«scheinbar fertig», weil ich zu der Ansicht<br />
gekommen bin, dass eine literarische<br />
Übersetzung niemals endgültig fertig ist.<br />
Wenn ich nach zehn oder zwanzig Jahren<br />
eine meiner Übersetzungen erneut ansehe,<br />
finde ich immer Stellen, die ich heute<br />
anders übersetzen würde als damals.<br />
Zur Person<br />
Karl-Ludwig Wetzig, geboren 1956<br />
in Düsseldorf, lehrte Skandinavistik<br />
an den Universitäten Göttingen und<br />
Reykjavík und übersetzt seit 20 Jahren<br />
Literatur aus nordischen Sprachen,<br />
darunter Werke von Autoren wie<br />
Jón Kalman Stefánsson, Gunnar<br />
Gun narsson und Hallgrímur Helgason<br />
sowie mittelalterliche Isländersagas.<br />
Daneben veröffentlicht er eigene<br />
Bücher. Für seine Übersetzung von<br />
«Dein Fortsein ist Finsternis» erhielt<br />
er <strong>2023</strong> den Christoph-Martin-<br />
Wieland- Übersetzerpreis.<br />
Inwiefern sind Sie in den übersetzten<br />
Werken spürbar?<br />
Der ideale Übersetzer ist in den Augen vieler<br />
der unsichtbare Übersetzer; eine gläserne<br />
Instanz, die den Lesenden das Original<br />
auf allen Ebenen möglichst ohne eigenes<br />
Zutun oder Weglassen nahebringt. Die<br />
vorhin erwähnten Beispiele zeigen, dass<br />
das eine Illusion ist. Es gibt keine Übersetzung<br />
ohne Eingriffe. Dennoch habe ich<br />
mich anfangs gewundert, als ein Kollege<br />
einmal behauptete, er würde selbstverständlich<br />
jedes von mir übersetzte Buch<br />
auch ohne Nennung meines Namens erkennen.<br />
Ja, es ist wohl so: Übersetzerinnen<br />
und Übersetzer entwickeln im Lauf<br />
der Zeit ihre eigene, wiedererkennbare<br />
Sprache – auch wenn sie ganz unterschiedliche<br />
Werke übersetzen.<br />
Wie stark tauschen Sie sich jeweils mit<br />
den Autorinnen und Autoren aus?<br />
Ich selbst nehme vor Beginn einer Übersetzung<br />
fast immer Verbindung zur Autorin<br />
oder zum Autor auf, besonders wenn es<br />
um komplexe, schwierigere Werke geht.<br />
Da finde ich es enorm hilfreich, wenn ich<br />
mich rückversichern kann, ob ich die eine<br />
oder andere Textstelle auch wirklich im<br />
Sinn der Textintention verstanden habe.<br />
Der Austausch kann sehr fruchtbar und<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 5/23 29