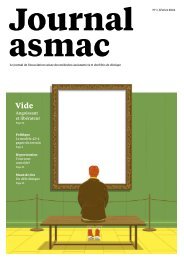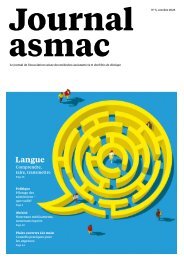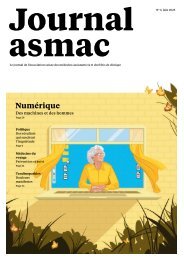vsao Journal Nr. 5 - Oktober 2023
Sprache - Verstehen, verstummen, vermitteln Politik - Zulassungssteuerung – quo vadis? Adipositas - Neue Medikamente wecken Hoffnungen Offene Handverletzungen - Tipps und Tricks für den Notfall
Sprache - Verstehen, verstummen, vermitteln
Politik - Zulassungssteuerung – quo vadis?
Adipositas - Neue Medikamente wecken Hoffnungen
Offene Handverletzungen - Tipps und Tricks für den Notfall
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fokus: Sprache<br />
Sprechen, Hören und Verstehen das Verständnis<br />
der allgemeinen Strukturen und<br />
Funktionsweisen von Sprache vertiefen.<br />
Kommunikation bei Kopfschmerzen<br />
Vor dem Hintergrund dieses Potentials<br />
wurde 2021 an der Universität Zürich das<br />
Kompetenzzentrum Language & Medicine<br />
Zurich gegründet [3] (siehe Box).<br />
Zwei Beispiele für Projekte:<br />
Während Kommunikation im klinischen<br />
Handeln allgemein als wichtig<br />
erachtet wird, wie etwa die häufigen Praxistipps<br />
zu diesem Thema in der Schweizer<br />
Ärztezeitung zeigen [4], ist klinische<br />
Kommunikation in der medizinischen<br />
Forschung und Lehre unterrepräsentiert.<br />
Das Projekt «ComPain – Communication<br />
of Pain in Patients with Headache» [5]<br />
steht an der Schnittstelle von Neurologie,<br />
Psychiatrie und Linguistik. Auf Video<br />
aufgezeichnete Konsultationen in der<br />
Kopfschmerzsprechstunde am Universitätsspital<br />
Zürich werden gemeinsam mit<br />
klinischen Daten analysiert, um diagnostisch<br />
relevante sprachliche Muster sowie<br />
Zusammenhänge von Kommunikation und<br />
Behandlungszufriedenheit zu erkennen.<br />
Sprechen über psychische<br />
Erkrankungen<br />
Im Projekt «Drüber reden! Aber wie?»<br />
(www.drueberreden.ch) sind Betroffene<br />
und Angehörige eingeladen, von ihren<br />
Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen<br />
zu erzählen. Fachpersonen und<br />
Betroffene analysieren anschliessend gemeinsam<br />
die auf Video aufgezeichneten<br />
Gespräche. Der Fokus liegt dabei auf<br />
den kommunikativen Ressourcen der<br />
Teil nehmenden zur Überwindung der<br />
Schwierigkeit, die das Sprechen über psychische<br />
Erkrankungen gerade ausserhalb<br />
des klinischen Kontexts häufig darstellt<br />
[6]. Zudem wird auf Basis dieser Daten<br />
ein Modul zur psychischen Gesundheit<br />
für die Schweizer Datenbank für Gesundheits-<br />
und Krankheitserfahrungen (DIPEx,<br />
www.dipex.ch) erarbeitet.<br />
Ein Kompetenzzentrum für Sprache und Medizin<br />
Das Kompetenzzentrum Language & Medicine Zurich wird von Prof. Dr. Johannnes<br />
Kabatek, Romanisches Seminar, und Prof. Dr. Nathalie Giroud, Arbeitsgruppe «Neurowissenschaften<br />
der Sprache und des Hörens», geleitet. Es dient als Ideenschmiede und<br />
Ort des inter- bzw. transdisziplinären Lernens und vernetzt Klinikerinnen und Kliniker<br />
mit Forschenden insbesondere aus der (Computer-)Linguistik und der Neurowissenschaft.<br />
Forschungskolloquien und Events wie etwa der Language&Medicine-Market<br />
bieten die Möglichkeit, Forschungsprojekte vorzustellen und Kontakte zu knüpfen.<br />
Weiter soll das Zentrum den Austausch zu unterschiedlichen Methoden und Herangehensweisen<br />
fördern und bestehende Ressourcen bündeln und koordinieren.<br />
Markenzeichen ist dabei die konsequent gelebte Interdisziplinarität, also die Kollaboration<br />
zwischen Medizin und Linguistik und den jeweils verwandten Wissenschaften.<br />
Mit der Vergabe von Seed-Grants konnten jüngst mehrere Vorhaben interdisziplinärer<br />
Zusammenarbeit gefördert werden. Thematisch haben sich bisher die folgenden<br />
Bereiche herauskristallisiert:<br />
– Stimm-, Sprech- und Sprachplastizität,<br />
– sprachliche Marker zur Prädiktion von Krankheits- und Therapieverlauf<br />
bei (neuro)psychiatrischen Erkrankungen,<br />
– klinische Kommunikation, einschliesslich der Frage der Mehrsprachigkeit<br />
und der Mundartkommunikation.<br />
Weitere Informationen unter www.language-and-medicine.uzh.ch<br />
Diskussion und Ausblick – oder:<br />
Was bringt’s?<br />
Das «Alltagsgeschäft der Interdisziplinarität»<br />
[7] bedeutet immer auch einen Mehraufwand,<br />
zeitlich und personell. Was also<br />
ist der Nutzen?<br />
Im klinischen Alltag führt der Einbezug<br />
der Sprachwissenschaft zu einer höheren<br />
Achtsamkeit für die verbale und nonverbale<br />
Kommunikation: Wie spreche ich?<br />
Wie spricht mein Gegenüber? Wie sprechen<br />
wir miteinander? Wie benutze ich<br />
Fachsprache? Wie setze ich technische und<br />
digitale Hilfsmittel in der Kommunikation<br />
ein? Die Sprachwissenschaft ermöglicht es,<br />
entsprechende Beobachtungen systematisch<br />
zu erfassen, kommunikative Ressourcen<br />
sichtbar zu machen sowie diese<br />
hinsichtlich ihrer klinischen Wirkung zu<br />
untersuchen und zu verbessern.<br />
Aus Sicht der Sprachwissenschaft bietet<br />
die Zusammenarbeit mit der Medizin<br />
für die Forschung im klinischen Kontext<br />
erst die Möglichkeit, verschiedene Kommunikationsformen,<br />
ihren Kontext sowie<br />
relevante pathologische Phänomene adäquat<br />
zu untersuchen, zu verstehen und<br />
Ergebnisse in die Praxis zurückzuspielen.<br />
Nicht selten führt der medizinische Blickwinkel<br />
dabei zu neuen Fragen und Erkenntnissen,<br />
die für die Erforschung der<br />
menschlichen Kommunikation – auch unabhängig<br />
vom klinischen Kontext – relevant<br />
sind.<br />
Zwar ist die Linguistin in der Klinik –<br />
ausser zum Zweck der Erhebung von Forschungsdaten<br />
– noch nicht Realität, jedoch<br />
will das Kompetenzzentrum die Interdisziplinarität<br />
künftig besonders in der<br />
klinischen Kommunikation nutzen. Es<br />
soll eine Brücke schlagen zwischen Medizin<br />
und Geisteswissenschaft, zwischen<br />
Grundlagenforschung und klinischer Anwendung,<br />
um Diagnostik und Therapie<br />
durch die Erforschung sprachbezogener<br />
Phänomene im medizinischen Kontext zu<br />
verbessern.<br />
Literatur<br />
[1] Busch A, Spranz-Fogasy Th<br />
(2015): Sprache in der Medizin. In:<br />
Ekkehard Felder & Andreas Gardt (Hrsg.),<br />
Handbuch Sprache und Wissen. Berlin,<br />
Boston: De Gruyter. S. 335–357.<br />
[2] Iakushevich M, Ilg Y, Schnedermann<br />
Th (2021): Linguistik und Medizin:<br />
Einleitung. In: Linguistik und Medizin.<br />
Sprachwissenschaftliche Zugänge und<br />
interdisziplinäre Perspektiven, hrsg. v.<br />
dens. Berlin, Boston: De Gruyter. S. 1–10.<br />
https://doi.org/10.1515/9783110688696.<br />
[3] Ilg Y, Maatz A (2022):<br />
Leichter gesagt als getan? Ein Bericht aus<br />
der interdisziplinären Praxis zwischen<br />
Linguistik und Medizin. Scientia Poetica<br />
26(1): S. 245–262.<br />
[4] Langewitz W (<strong>2023</strong>):<br />
Ich sage Katze, aber Du verstehst Schwein.<br />
Schweizer Ärztezeitung <strong>2023</strong>;104(22):<br />
S. 80–81.<br />
[5] Eicher E, Räz S, Stucki P, Röthlin<br />
C, Stattmann M et al. (<strong>2023</strong>): ComPAIN–<br />
Communication of Pain in Patients with<br />
Headache. Clin. Transl. Neurosci. 7, 14.<br />
https://doi.org/10.3390/ctn7020014.<br />
[6] Maatz A, Ilg Y, Wiemer H (2022):<br />
Einfach drüber reden? Eine interdisziplinäre<br />
Untersuchung zu Schwierigkeiten und<br />
Ressourcen beim Reden über Erfahrungen<br />
psychischer Erkrankung. Sozialpsychiatrische<br />
Informationen 3: S. 6–12.<br />
[7] Gülich, E (2006): Das Alltagsgeschäft<br />
der Interdisziplinarität. Deutsche<br />
Sprache 34(1-2): S. 6–17.<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 5/23 39