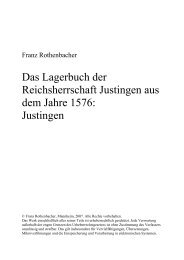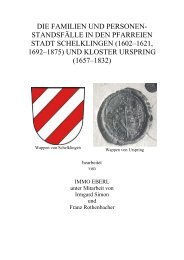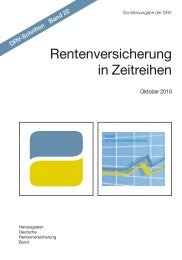Working papers Arbeitspapiere - Mzes - Universität Mannheim
Working papers Arbeitspapiere - Mzes - Universität Mannheim
Working papers Arbeitspapiere - Mzes - Universität Mannheim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4. Zusammenfassung<br />
In der international vergleichenden Mobilitäts- und Ungleichheitsforschung nimmt das EGP-Schema<br />
einen zentralen Stellenwert ein. Wie kaum ein anderes Konzept in der empirischen Ungleichheitsforschung,<br />
ist das EGP-Klassenschema zahlreichen theoretischen Diskussionen und - im nationalen wie<br />
internationalen Kontext - vielfältigen empirischen Anwendungen und Überprüfungen unterzogen worden.<br />
Das Schema ist theoretisch fundiert; die entscheidenden Dimensionen der Klassenpositionierung<br />
- Marktlage und Arbeitssituation - resultieren aus den unterschiedlichen Besitzverhältnissen und Möglichkeiten<br />
der Einkommenserzielung in Industriegesellschaften. Für die überwiegende Zahl der abhängig<br />
Erwerbstätigen in modernen Gesellschaften korrespondieren diese Dimensionen mit einer spezifischen<br />
Art des Beschäftigungsverhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, woraus die<br />
weiteren Differenzierungskriterien zwischen Dienstklassen und manuellen Arbeiterklassen abgeleitet<br />
werden. Bei der Unterscheidung zwischen Grundformen und Mischtypen von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen<br />
werden Kriterien der Arbeitssituation, wie z.B. der Grad an Arbeitsautonomie und<br />
der organisationsinternen Autoritäts- und Kontrollbefugnisse, aber auch Aspekte der Arbeitsmarktlage<br />
wie Arbeitsplatzsicherheit, Einkommen und Karrierechancen relevant.<br />
Die Operationalisierung bzw. Zuordnung von Personen oder Haushalten zu einzelnen EGP-Klassen<br />
erfolgt auf Basis grundlegender Informationen zur ausgeübten Berufstätigkeit und zur beruflichen sowie<br />
betrieblichen Stellung der Erwerbstätigen. Wie in den einzelnen Länderkapiteln beschrieben, werden<br />
diese erwerbsstatistischen Grunddaten in den amtlichen Erhebungen unterschiedlicher europäischer<br />
Nationen mit nahezu identischer Fragestellung ermittelt. Als Bestandteil der Arbeitskräfteerhebung<br />
der EU sind die hier präsentierten Datenquellen zudem in einen gemeinsamen methodischen<br />
Rahmen eingebettet, was sie in Verbindung mit weiteren Qualitätsmerkmalen, wie Stichprobenumfang<br />
und hohes Ausmaß an Repräsentativität der Daten, zu einer hervorragenden Datenbasis für die komparative<br />
Forschung werden läßt.<br />
Gleichwohl erweist sich die Konstruktion eines international vergleichbaren EGP-Klassenschemas als<br />
nicht unproblematisch. Ausgangsinformationen zum Beruf, zur Stellung im Beruf, zur betrieblichen<br />
Stellung sowie zur Anzahl der Mitarbeiter bei Selbständigen variieren teilweise zwischen nationalen<br />
Datenquellen und - innerhalb dieser - über sukzessive Erhebungen hinweg. Diese Variabilität führt dazu,<br />
daß länder- sowie zeitübergreifende Konsistenz in den Operationalisierungen zwar in hohem, aber<br />
nicht vollem Maße erreicht werden kann. Nicht nur die Konstruktion eines länder- und zeitübergreifend<br />
möglichst vergleichbaren Klassenschemas, auch die Interpretation empirischer Befunde, die auf der<br />
vorgenommenen Klassifikation basieren, setzen genaue Kenntnisse nationalspezifischer Besonderheiten<br />
in der Erhebung und Verarbeitung der Ausgangsinformationen voraus. Wie die vorausgehenden<br />
Ausführungen deutlich gemacht haben, zeigen sich länderspezifische Unterschiede in den zugrundeliegenden<br />
Ausgangsvariablen insbesondere in:<br />
72