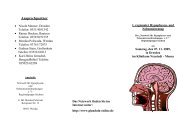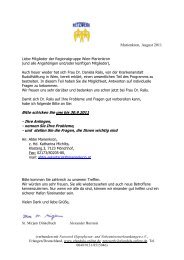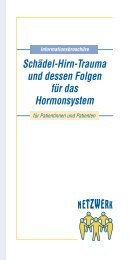**Glandula 19 - Netzwerk Hypophysen- und ...
**Glandula 19 - Netzwerk Hypophysen- und ...
**Glandula 19 - Netzwerk Hypophysen- und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Begleiterkrankungen<br />
Die mit der <strong>Hypophysen</strong>insuffizienz<br />
assoziierte Osteoporose – ein häufig<br />
unterschätzter Bef<strong>und</strong><br />
Eine Besonderheit der Osteoporose<br />
bei Patienten mit <strong>Hypophysen</strong>vorderlappen-Insuffizienz<br />
(HVL-OPO)<br />
ist das häufigere Auftreten von<br />
schweren Verläufen, besonders auch<br />
bei jungen Patienten. Die Diagnose<br />
„Osteoporose” wird entweder nur<br />
osteodensitometrisch nach sog.<br />
WHO-Kriterien <strong>und</strong>/oder klinisch<br />
anhand von Anamnese, Untersuchung,<br />
Knochendichte, bildgebenden<br />
Verfahren <strong>und</strong> Labor gestellt.<br />
Diagnosestellung<br />
Bei der Anamnese steht die Schmerzsymptomatik<br />
bzw. -freiheit im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Das Frühstadium osteoporotischer<br />
Osteopathien (sog. Osteopenie)<br />
ist meist schmerzfrei <strong>und</strong><br />
zeigt sich nur an einer erniedrigten<br />
Knochendichte, das Spätstadium ist<br />
charakterisiert durch typische Frakturen<br />
(Wirbelsäule, Speiche, Schenkelhals).<br />
Beim schmerzlosen Frühstadium<br />
der osteoporotischen Osteopathien<br />
ist die Erhebung der Risikofaktoren<br />
essenziell (Abb. 1). Positive<br />
Risikofaktoren sind per se Therapieindikationen<br />
oder führen dazu,<br />
dass bereits bei höheren Knochendichtewerten<br />
therapeutische Maßnahmen<br />
erfolgen sollten.<br />
Bei der körperlichen Untersuchung ist<br />
besonderes Augenmerk auf das Vorhandensein<br />
von Wirbelfrakturen zu<br />
legen, Schwerpunkt ist der Körpergrößenverlust<br />
(ein Verlust >4 cm<br />
gegenüber der im Pass angegebenen<br />
Größe ist pathologisch), der für<br />
Wirbelkörperfrakturen richtungsweisend<br />
ist.<br />
Die Osteodensitometrie (Abb. 2) ist<br />
Hauptbestandteil der Untersuchungen<br />
zur Früherkennung osteoporotischer<br />
Osteopathien (Knochenerkrankungen).<br />
Dabei sind die quantitative<br />
Computertomographie<br />
(QCT), die Dual-Röntgenabsorptiometrie<br />
(DXA) <strong>und</strong> die quantitative<br />
Osteosonographie (QUS) gleichwertig<br />
in der Bestimmung des Frakturrisikos.<br />
Auch periphere (Speiche,<br />
Fersenbein) bzw. axiale (Wirbelsäule,<br />
Schenkelhals) Messorte haben<br />
denselben Stellenwert bei der Abschätzung<br />
eines systemischen Knochenmassenverlustes.<br />
Die derzeitige Frakturrisiko-Abschätzung<br />
wird dabei am T-Wert<br />
(Abweichung vom Mittelwert von<br />
30-jährigen gleichgeschlechtlichen<br />
ges<strong>und</strong>en Personen) diagnostiziert<br />
<strong>und</strong> nach WHO eingeteilt. Zur Therapieentscheidung<br />
wird der Z-Wert<br />
(Abweichung vom Mittelwert von<br />
altersgleichen, gleichgeschlechtlichen<br />
Ges<strong>und</strong>en) herangezogen, hier<br />
liegt der Grenzwert bei –1 SD. Dieser<br />
Wert wird aber durch vorhandene<br />
Risikofaktoren (vgl. Abb. 1) nach<br />
Hormonelle Faktoren:<br />
<br />
<br />
<br />
Hypogonadismus<br />
Hyperthreose<br />
Cushing-Syndrom<br />
Erb-Faktoren:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Alter<br />
weiße / asiatische Rasse<br />
weibliches Geschlecht<br />
positive Familienanamnese (Mutter)<br />
zierlicher Körperbau<br />
Medikamente:<br />
<br />
<br />
Prof. Dr. med. Christian Wüster,<br />
Mainz<br />
oben verschoben. Diese Definition<br />
ist praktikabel, aber sicher nicht perfekt.<br />
Wie bei der Beurteilung der<br />
meisten anderen Erkrankungen sind<br />
die Anamnese sowie die physikalische<br />
<strong>und</strong> biochemische Untersuchung<br />
unerlässlich <strong>und</strong> müssen für<br />
die Diagnosestellung <strong>und</strong> Therapieentscheidung<br />
mit herangezogen werden.<br />
Zum Therapiemonitoring dienen<br />
sog. Knochenmarker wie z. B. das<br />
Serum-Osteocalcin oder die Urinausscheidung<br />
der Desoxypyridinoli-<br />
Glukokortikoide<br />
Schilddrüsenhormone<br />
HLV-OPO<br />
Ernährung <strong>und</strong> Lebensstil:<br />
Erhöhte Fallneigung:<br />
Abbildung 1: Risikofaktoren für die Entstehung einer HVL-Insuffizienz-assoziierten Osteoporose<br />
(HVL-OPO).<br />
<br />
<br />
<br />
Kardiale Arrhythmien<br />
bei Elektrolytstörungen<br />
bei Diabetes insipidus<br />
Sehstörungen<br />
durch Gesichtsfeldeinschränkungen<br />
Antiepileptika-Therapie<br />
Ernährung: kalziumarm, Vitamin-D-arm<br />
Genussmittel: Nikotin, Alkohol<br />
Phys. Aktivität: Immobilisation, Inaktivität<br />
Rel. zu wenig Sonne, z.B. oriental. Ursprungs<br />
30<br />
GLANDULA <strong>19</strong>/04