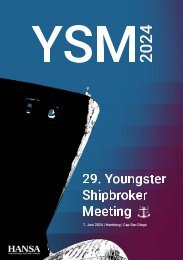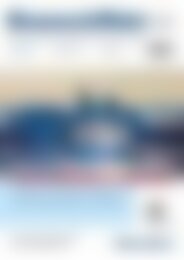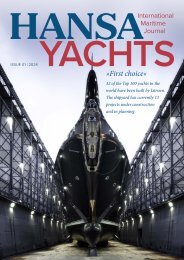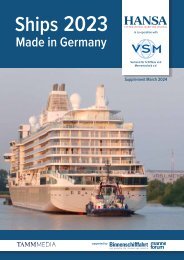HANSA 03-2018
Propeller Performance | Koalitionsvertrag | Jubiläum ZVDS | Robotik im Hafen | Ballastwasser Survey 2018 | Finanz- und Schifffahrtsstandort Nordamerika | Zeaborn & Rickmers
Propeller Performance | Koalitionsvertrag | Jubiläum ZVDS | Robotik im Hafen | Ballastwasser Survey 2018 | Finanz- und Schifffahrtsstandort Nordamerika | Zeaborn & Rickmers
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schiffstechnik | Ship Technology<br />
Quelle: HSVA<br />
»Hauptsache schnell« zählt nicht mehr<br />
Kleiner Aufwand, große Wirkung – Nabenkappenflossen und für Slow Steaming<br />
optimierte Propeller liegen im Trend, während Numerik und 3D-Druck die Entwurfsund<br />
Testprozesse verändern. Von Felix Selzer<br />
Nabenkappenflossen sind eines der<br />
»Hot Topics«, mit denen sich die Experten<br />
an der Hamburgischen Schiffbau-<br />
Versuchsanstalt (HSVA) derzeit beschäftigen.<br />
Die hinter dem Propeller auf der<br />
Ablaufhaube angebrachten Flügel sollen<br />
Energie aus dem Nabenwirbel zurückgewinnen.<br />
Auch Kappel-Propeller,<br />
die durch leicht gebogene Flügelspitzen<br />
deutliche Effizienzzugewinne versprechen,<br />
werden vermehrt nachgefragt und<br />
getestet. »Was die Nabenkappenflossen<br />
angeht, haben wir sogar eine neue Versuchstechnik<br />
entwickelt«, sagt Christian<br />
Johannsen, Leiter der Abteilung Propeller<br />
und Kavitation an der HSVA. Klassischerweise<br />
würden Propulsionsversuche<br />
im Schlepptank gemacht und Kavitationsversuche<br />
im Kavitationstunnel. Im<br />
Tank müsse man sich stets um das froudsche<br />
Ähnlichkeitsgesetz kümmern, was<br />
aber nur relativ niedrige Propellerdrehzahlen<br />
erlaube, wodurch Reibungseffekte<br />
überzeichnet würden. »Das ist gerade<br />
bei den Nabenkappenflossen ein Problem,<br />
weil der Gewinn, den sie bringen,<br />
durch die zusätzliche Reibung aufgezehrt<br />
wird. Daher haben wir eine Technik<br />
entwickelt, bei der die vergleichenden<br />
Propulsionsversuche bei sehr viel<br />
höherer Geschwindigkeit im Kavitationstunnel<br />
gemacht werden. Dabei lässt<br />
sich nicht absolut der Leistungsbedarf eines<br />
Schiffes ermitteln, aber den Unterschied<br />
zwischen einem Schiff mit und<br />
einem Schiff ohne Nabenkappenflossen<br />
kann man auf diese Weise sehr genau<br />
bestimmen«, so der Experte. Das werde<br />
derzeit stark nachgefragt von Werften<br />
und Reedereien.<br />
Der Grund dafür ist der Trend zum<br />
»Slow Steaming«. Schließlich sind noch<br />
viele Schiffe im Markt, bei deren Design<br />
Geschwindigkeit oberstes Ziel war. Den<br />
gegenteiligen Trend gibt es schon seit einer<br />
Weile, dennoch beobachtet Johannsen<br />
immer noch eine starke Nachfrage<br />
nach der Anpassung von Schiffen mit<br />
möglichst geringem Aufwand.<br />
»Fährt das Schiff langsam, geht der<br />
Leistungsbedarf dramatisch zurück, die<br />
Kavitationsgefahr sinkt von allein und<br />
man kann näher an das Wirkungsgradoptimum<br />
heran designen«, erklärt Johannsen.<br />
Auch Hans-Jürgen Heinke,<br />
Head of Department Propeller & Cavitation<br />
an der SVA Potsdam, sieht durch den<br />
Trend hin zu geringen Schiffsgeschwindigkeiten,<br />
kleinen Drehzahlen und großen<br />
Durchmessern zur Reduzierung der<br />
Propellerbelastung ganz neue Freiräume<br />
für den Entwurf. Diese könnten z.B. genutzt<br />
werden, um das Flächenverhältnis<br />
zu reduzieren und auch die Wahl der üblichen<br />
Flügelzahl in Frage zu stellen. Bei<br />
der Reduktion des Flächenverhältnisses<br />
und der Flügelzahl mit dem Ziel der Wirkungsgradsteigerung<br />
dürften die anderen<br />
Aspekte der Propelleroptimierung, wie<br />
Einhaltung der Grenzen für die Druckschwankungsamplituden<br />
und die breitbandige<br />
Schallabstrahlung, außer Acht<br />
gelassen werden. Dies gelinge immer besser<br />
durch die Anwendung moderner Optimierungsverfahren<br />
für die Propellerauslegung<br />
mit Mehrzielkriterien.<br />
Die speziellen Propellertypen und Nabenkappen<br />
werden derzeit auch von den<br />
Herstellern selbst sehr stark forciert. Üblicherweise<br />
zahlt die Modellversuche die<br />
Werft, aber es gibt laut Johannsen mehr<br />
und mehr Fälle, in denen die Hersteller<br />
die Kosten übernehmen oder sich beteiligen.<br />
»Für ein Schiff werden verschiedene<br />
Propellerentwerfer eingeladen, die<br />
ihre Entwürfe präsentieren, die dann hier<br />
getestet werden. Früher hatte die Werft<br />
ihren Haus- und Hof-Propellerhersteller,<br />
der hat den Entwurf gemacht, dieser<br />
wurde getestet und genommen, wenn er<br />
gut war. Heutzutage sehen wir regelrechte<br />
Wettbewerbe«, berichtet er.<br />
Der Potsdamer Experte beobachtet,<br />
dass sich mit der Fokussierung auf Passagier-<br />
und Spezialschiffbau in Europa<br />
die Nachfrage in der Propellerentwicklung<br />
für Neubauprojekte gewandelt hat.<br />
Gefordert würden Propeller und Propulsionssysteme<br />
für Spezialschiffe, große<br />
Yachten, Forschungs- und Marineschiffe<br />
mit hohem Wirkungsgrad und<br />
gleichzeitig einem niedrigen Druckschwankungs-<br />
und Schallpegelniveau.<br />
Diese zum Teil gegenläufigen Entwurfsziele<br />
erfordern besondere Sorgfalt beim<br />
Propellerentwurf.<br />
Immer mehr in den Fokus rücke die<br />
Schallabstrahlung von Schiffen. Im Falle<br />
von Kreuzfahrtschiffen und Yachten geht<br />
es um den Komfort an Bord, bei Propelleranwendungen<br />
für Marine- und For-<br />
68 <strong>HANSA</strong> International Maritime Journal – 155. Jahrgang – <strong>2018</strong> – Nr. 3