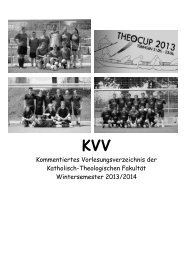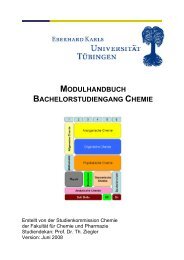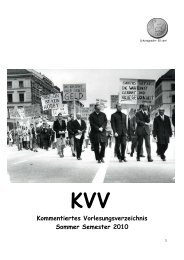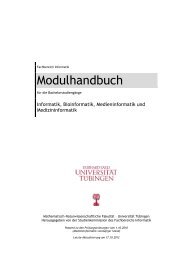Paul Dräger zu:* Homer, Ilias. Übertragen von Raoul Schrott ...
Paul Dräger zu:* Homer, Ilias. Übertragen von Raoul Schrott ...
Paul Dräger zu:* Homer, Ilias. Übertragen von Raoul Schrott ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Raoul</strong> <strong>Schrott</strong>: <strong>Homer</strong>, <strong>Ilias</strong> und <strong>Homer</strong>s Heimat<br />
(1) Verkennung der Autonomie des Originals:<br />
Die „Achaier“ des Originals werden bei <strong>Schrott</strong> didaktisch aufdringlich<br />
<strong>zu</strong> beliebigen „griechen“ (V. 2); die „göttin“ aus V. 1 wird in V. 6 <strong>zu</strong>r im<br />
Original nicht vorhandenen „muse“; der „Atride“ (V. 7) <strong>zu</strong> „agamemnon“;<br />
30 „Letos und Zeus’ Sohn“ (V. 9) umständlich erklärend und belehrend<br />
<strong>zu</strong> „es war apollon, zeus’ sohn mit leto“, und der „König“ (V. 9)<br />
wieder <strong>zu</strong> „agamemnon“. Diese explizit modernisierende Belehrungs-Intention<br />
– <strong>Schrott</strong>s erklärtes Arbeitsprinzip 31 – ist <strong>Homer</strong> natürlich fremd<br />
und daher mit allen aus ihr entsprungenen Wiedergaben 32 für etwas,<br />
30 Warum wird ᾿Ατρε�δης durch „agamemnon“ ersetzt? <strong>Schrott</strong>s (‚kontextbezogene’: s.<br />
unten S. 31-35) Ausdeutung würde doch in seinem Sinn passen (Prämissen [wie Anm.<br />
26] S. 200): „Agamemnon als ‚Sohn des Atreus’ <strong>zu</strong> bezeichnen, bringt immer seine<br />
brutale und zerrissene Familiengeschichte mit ein und erklärt damit <strong>zu</strong>sätzlich seine<br />
impulsiv aggressive Art. Das Epitheton tippt damit einen dem Publikum bekannten<br />
Hintergrund an, einen anderen Mythos – gleichsam als Vorform <strong>von</strong> Intertextualität“<br />
(dass das freilich reine Phantasie ist, zeigt Latacz, <strong>Homer</strong> übersetzen [wie Anm. 26] S.<br />
376).<br />
31 S. XXXIV: „Diese Fassung schreibt deshalb gewissermaßen als Metaversion mit, was<br />
wir jetzt [!] über den Text und seine Hintergründe wissen“; so schon Sieben Prämissen<br />
(wie Anm. 26) S. 197; programmatisch: Replik (wie Anm. 26) S. 475. Nach diesem<br />
Prinzip müssten wir z.B. in Goethes ‚Iphigenie’ I 1 („Wenn du [... / ...] / die Gattin ihm,<br />
Elektren und den Sohn, / die schönen Schätze, wohl erhalten hast ... [...]“) nach<br />
„Elektren“ gleich zeigefingerhebend in den Goetheschen Originaltext einen Plusvers<br />
einfügen: ‚(Elektra also, Agamemnons zweite Tochter, und Orest)’. Sollen wir in Zukunft<br />
die klassischen Texte der Weltliteratur durch Anbiederung an ein vermeintlich<br />
denkunfähiges Publikum tatsächlich in dieser Weise systematisch zerstören? Kein<br />
noch so schönklingendes theoretisches Räsonnement über die angebliche Notwendigkeit,<br />
„<strong>Homer</strong> <strong>von</strong> seinem Ufer ab<strong>zu</strong>holen, um ihn ins Heute <strong>zu</strong> bringen“ (S. XXXIII; vgl.<br />
etwa „Aspekte“ 5/2008, S. 474f. über eine „andere [!] Form der Texttreue“ [...] die „unsere<br />
heutigen Kenntnisse – <strong>von</strong> Wortetymologien über die Realien bis <strong>zu</strong>m archäologischen<br />
oder mythologischen Hintergrund – einarbeitet“) kann derartig demolierende<br />
Eingriffe in Original-Texte rechtfertigen. Was sich als joviale Fürsorge für den heutigen<br />
Leser ausgibt, ist in Wahrheit nicht nur Schändung des Autors, sondern auch Entmündigung<br />
des Lesers. Bei Goethe würde <strong>Schrott</strong> davor vielleicht noch <strong>zu</strong>rückschrecken.<br />
Antike Dichter aber sind für ihn schon seit der ‚Erfindung der Poesie’ (1997) abschussreifes<br />
und ausweidbares Freiwild (<strong>zu</strong>r ‚Erfindung der Poesie’ s. Leopold Federmair,<br />
Der große Poesie-Schwindel. Über <strong>Raoul</strong> <strong>Schrott</strong>s Erfindungen, in: Merkur<br />
6/2001, S. 495-508; <strong>zu</strong> <strong>Schrott</strong>s ‚Gilgamesh-Epos’ [2001] s. Stefan Maul, Sei ihm ein<br />
Rücken, ein Hügel. Vom Umgang des gelehrigen Lyrikers <strong>Raoul</strong> <strong>Schrott</strong> mit der englischen<br />
Ausgabe eines babylonischen Epos, in: Literaturen 1/2, 2002, S. 62-64).<br />
32 Siehe z.B. 1,43: „der gott des lichts“ (für ‚Phoibos Apollon’; erneut so erläutert im<br />
Komm. Mauritschs: wo<strong>zu</strong>, wenn doch schon die ‚Metaversion’ einen Kommentar ersetzen<br />
soll? Wohin diese verkrampfte Methode überdies im Hinblick auf die Sachpräzision<br />
führen kann, beklagt Mauritsch selbst, z.B. im Komm. <strong>zu</strong> 4,105ff.: „bogen – in die<br />
Beschreibung der Herstellung des Bogens ist in der Überset<strong>zu</strong>ng Kommentarwissen<br />
[meine Hervorhebung] eingeflossen, er wird so – anders als im Text – <strong>zu</strong>m Kompositbogen“);<br />
aufgenommen 1,64, mit Farbwort-Spiel: „warum der sonst so lichte apollon in<br />
solch dunklen zorn geriet“ (statt hom. ‚warum Phoibos Apollon so sehr in Zorn geriet’);<br />
1,73: „mit der er (Kalchas) nun alles ins rechte licht <strong>zu</strong> rücken versuchte“ (statt hom.<br />
‚der aber, für sie auf das Rechte sinnend, fing an <strong>zu</strong> reden und sagte’); 1,268: „mischwesen<br />
aus pferd und mensch“ (im Original nur �ηρσ�ν; im Komm. da<strong>zu</strong>: „nicht im<br />
17