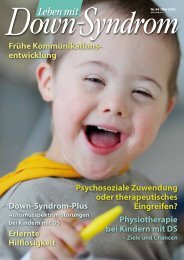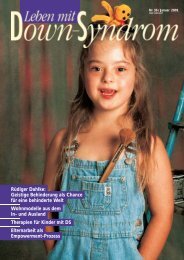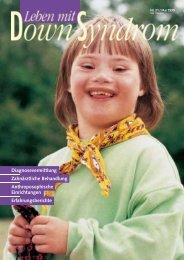Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� � PSYCHOLOGIE<br />
Rituale im Leben von Menschen<br />
mit einer geistigen Behinderung<br />
TEXT: WERNER FRANGER<br />
Rituale erleichtern den Alltag. Unser Leben ist voll<br />
davon. Rituale haben ihren Platz beim Verstehen<br />
von Welt und im Handeln in der Welt. Sie bringen<br />
Sicherheit und Routine, aber auch Starrheit und<br />
Stagnation. Der Begriff „Ritual“ wird meist im Zusammenhang<br />
mit Kindererziehung erwähnt, zum<br />
Beispiel Einschlafritual oder Spielritual. In unserem<br />
Alltag fi nden sich jedoch die unterschiedlichsten<br />
Rituale, Gewohnheiten, Handlungsabläufe.<br />
In diesem Bericht fasst der Autor den Begriff<br />
„Ritual“ wesentlich weiter. Die Verengung alleine<br />
auf Gewohnheiten würde den Blick auf weitere<br />
Aspekte und Wirkweisen von Ritualen verstellen.<br />
Wenn man heute den Begriff „Ritual“ hört, wird er meist im<br />
Zusammenhang mit Kindererziehung erwähnt. Einschlafritual,<br />
Spielritual, Ausziehritual usw. sind Handlungen, die in der<br />
„Ratgeberliteratur“ den Eltern Hilfen und Unterstützung anbieten<br />
wollen.<br />
Es ist schade, dass der Begriff und sein Inhalt weitgehend auf<br />
die Ebene der Kindererziehung reduziert werden. Unbestritten<br />
handelt es sich dabei um Rituale, bei näherem Hinsehen fi ndet<br />
sich in unserem Alltag jedoch eine große Anzahl unterschiedlichster<br />
Rituale, Gewohnheiten, Handlungsabläufe.<br />
Der Begriff „Ritual“ wird hier wesentlich weiter gefasst. Die<br />
Verengung alleine auf Gewohnheiten würde den Blick auf weitere<br />
Aspekte und Wirkweisen von Ritualen verstellen.<br />
Neben Alltagsritualen gibt es noch hochwirksame Rituale,<br />
die Übergänge markieren, z.B. markiert ein Hochzeitsritual den<br />
Übergang vom Single-Dasein zum Leben als Ehepaar. E. Imber-<br />
Black bezeichnet diese Form als „normative Rituale“.<br />
Normative Rituale folgen meist einer genau festgelegten<br />
Struktur und führen durch einen symbolischen Akt in das<br />
„Neue“.<br />
Eine Entscheidung, ob ein Ritual „normativ“ oder „alltäglich“<br />
ist, ist immer nur im Einzelfall möglich. Neben der Häufi gkeit<br />
und der Gefühlsladung kann als Unterscheidungsmerkmal dienen,<br />
dass bei normativen Ritualen das Gefühl im Ritual (im symbolischen<br />
Akt) präsent ist, während bei alltäglichen Ritualen die<br />
Abwesenheit oder das Misslingen der Routinehandlung zu Irritationen<br />
führt. Die starke emotionale Komponente normativer Rituale<br />
zeigt sich beispielsweise darin, dass bei diesen Ritualen die<br />
Menschen oft „zu Tränen gerührt“ sind (z.B. Hochzeiten). Bei all-<br />
16 Leben mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>58</strong> I <strong>Mai</strong> 2008<br />
täglichen Ritualen erwartet das Gehirn einen bestimmten Verlauf,<br />
tritt dieser nicht ein oder ist er gestört, wird eine Irritation<br />
die Folge sein. Beispiel: Wenn man frühmorgens feststellt, dass<br />
kein Kaffee mehr da ist für das gewohnte Muntermachergetränk.<br />
Für manche ist die Irritation dann so groß, dass „der Tag gelaufen<br />
ist“.<br />
Wesentliche Kriterien für ein Ritual sind seine Wirkung auf das<br />
Individuum, seine Gestaltung und die Häufi gkeit der Wiederholung.<br />
Die „Kraft“ oder „Mächtigkeit“ eines Rituals ist erkennbar an<br />
der Bedeutung dieses Rituals für ein Individuum oder eine Gruppe<br />
von Individuen (z.B. symbolisieren Aufnahmerituale die Zugehörigkeit<br />
zu einem Subsystem).<br />
In Ländern, in denen keine Trennung von Zivilgesellschaft und<br />
Religionsgemeinschaft existiert, lässt sich ein wesentlich höherer<br />
Anteil an normativen Ritualen im normalen Alltag fi nden als in<br />
Systemen, die eine Trennung von Religion und politischem System<br />
vollzogen haben. Jedes System (soziale Gruppe, insbesondere<br />
aber Glaubenssysteme) entwickelt Eigenarten im Umgang<br />
der Subsysteme untereinander, die es von anderen Subsystemen<br />
unterscheidbar macht.<br />
Beispiele in Israel stellen dar, wo die religiösen Elemente untrennbarer<br />
Teil des „politischen“ Alltags sind (z.B. Sabbat, Bar-<br />
Mizwa); oder auch der Islam, bei dem im Extremfall die „Sharia“<br />
als weltlich-politische Handelsmaxime eine Gesellschaft bestimmt.<br />
In Asien oder in Südamerika sind mystische Rituale zu<br />
fi nden (z. B. Woodoo, Feuerlaufen, Nagelbrett), die aber Bestandteil<br />
des kulturellen Lebens der jeweiligen Gesellschaft sind. Rituale<br />
sind elementarer Bestandteil von Kultur. Sie halten Verhaltensmuster<br />
für defi nierte Situationen bereit.<br />
In institutionellen Systemen (Firmen, soziale Einrichtungen)<br />
wird im Zusammenhang mit Leitbilddiskussion und Qualitätsmanagement<br />
seit einigen Jahren der Begriff der „Corporate Identity“<br />
bemüht, um identitätsstiftende Elemente zu implementieren.<br />
Dabei werden auch Rituale entwickelt, z.B. die monatliche<br />
Ernennung zum „Mitarbeiter des Monats“. Die wirkliche Kraft<br />
von Ritualen wird im sozialen Bereich nur am Rande erfasst, weil<br />
wichtige Elemente, die Voraussetzung für die Wirksamkeit eines<br />
Rituals sind, nicht beachtet werden.<br />
In Einrichtungen der Behindertenhilfe sind es die Kirchen,<br />
die durch ihre vielen Rituale zur „Kultur“ der Einrichtungen beitragen.<br />
Weltliche Rituale sind äußerst selten. Es existieren in den<br />
meisten Betrieben Rituale für die Mitarbeiter/-innen (z.B. Verabschiedung<br />
in den Ruhestand, Betriebsfeste); für die Klientel reduziert<br />
sich die Möglichkeit ritueller Gestaltung des Alltags aber<br />
erheblich. Es gibt meist keine Aufnahmerituale oder sonstigen<br />
Markierungen von Übergängen von einem Lebensbereich oder<br />
-abschnitt in einen anderen. Es gibt in Einrichtungen keine Traditionen<br />
hierfür und damit fehlen auch die Möglichkeiten, die Vorteile<br />
von Ritualen zu nutzen.<br />
Die meisten sozialen Systeme fallen unter die Kategorie „Unterritualisiert“<br />
in Bezug auf „normative Rituale“.