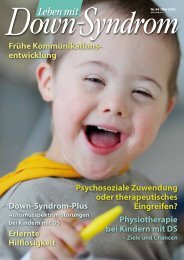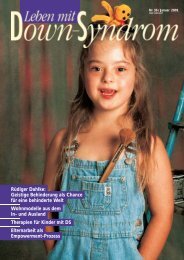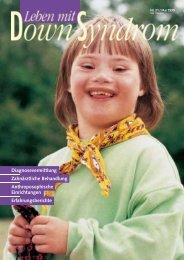Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� � SPRACHE<br />
men der Kinder wurden aus Gründen des<br />
Datenschutzes von mir geändert.)<br />
Die Kinder meiner Klasse:<br />
Marcel<br />
Marcel ist neun Jahre alt und hat eine allgemeine<br />
Entwicklungsstörung. Er hat keine<br />
Hörbehinderung, aber Teilleistungsstörungen<br />
in nahezu allen Bereichen. Marcel<br />
stammt aus einer sozial schwachen Familie<br />
und verbringt den Tag in der Heimstätte.<br />
Sein Sprachstand entspricht ungefähr dem<br />
eines Sechsjährigen.<br />
Pawel<br />
Pawel ist ein zehnjähriger Bub mit <strong>Down</strong>-<br />
<strong>Syndrom</strong> aus einer polnischen Familie. Mit<br />
sieben Jahren hatte Pawel Paukenröhrchen.<br />
Sein auditives Wahrnehmungsvermögen<br />
und die auditive Merkfähigkeit sind wie bei<br />
vielen Kindern mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> leicht<br />
eingeschränkt. Er spricht hauptsächlich in<br />
Zwei-Wort-Sätzen mit Nomen-Infi nitiv-<br />
Verbindungen. Zu Hause wird vor allem<br />
Polnisch gesprochen.<br />
Anna<br />
Anna ist neun Jahre alt. Sie zeigt massive<br />
Entwicklungsverzögerungen in allen Bereichen<br />
und wird nach dem ASO-Lehrplan<br />
beschult. Annas Mutter ist Ungarin<br />
und auch mit der Oma wird zum Teil Ungarisch<br />
gesprochen. Anna scheint sowohl<br />
auf Ungarisch als auch auf Deutsch sehr<br />
viel zu verstehen und spricht mit der Mutter<br />
in Ein- und Zwei-Wort-Sätzen. Dabei<br />
vermischt sie oft ungarische mit deutschen<br />
Wörtern. Da sie mit niemandem spricht außer<br />
ihrer Mutter, ist der Stand ihrer Sprachentwicklung<br />
schwer einzuschätzen. Seit<br />
kurzem spricht Anna einzelne Wörter auf<br />
Deutsch, meist Nomen, auch in der Klassensituation.<br />
Zoran<br />
Zoran ist ein zwölfj ähriger Bub aus einer serbischen<br />
Familie. Er hat eine mittel- bis hochgradige<br />
Hörbehinderung, die erst im Alter<br />
von vier Jahren entdeckt wurde. Zoran war<br />
eine Frühgeburt (ca. 950 Gramm Geburtsgewicht)<br />
und weist leichte Entwicklungsverzögerungen<br />
auf. Die Eltern sprechen sehr<br />
wenig Deutsch, zu Hause wird ausschließ-<br />
42 Leben mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>58</strong> I <strong>Mai</strong> 2008<br />
lich Serbisch gesprochen. Er hat eine jüngere<br />
Schwester, die gut Deutsch spricht und völlig<br />
altersgemäß entwickelt ist. Zoran kann nur<br />
wenige Bilder und Gegenstände lautsprachlich<br />
auf Deutsch richtig benennen, sein visuelles<br />
Gedächtnis jedoch ist sehr gut entwickelt.<br />
Über die deutsche Schrift sprache hat<br />
er einen recht großen passiven Wortschatz<br />
entwickelt. Seine Wünsche und Bedürfnisse<br />
kann er lautsprachlich nur in Ein-Wort-Sätzen<br />
ausdrücken und ist meist auf das Zeigen<br />
und Hantieren mit konkreten Dingen angewiesen.<br />
Durch die Betonung der wichtigen Wörter und die Visualisierung<br />
des Gesprochenen wird den Kindern das Verstehen erleichtert.<br />
Yvonne<br />
Yvonne ist 15 Jahre alt und seit einer Herzoperation<br />
als Baby geistig schwerstbehindert.<br />
Sie ist Spastikerin und braucht im<br />
Alltag viel Hilfe. Yvonne hat große Konzentrationsprobleme,<br />
ihre Sprache ist aber<br />
sowohl passiv als auch aktiv verhältnismäßig<br />
gut entwickelt. Mit eintrainierten Reihensätze<br />
und Floskeln kann sie ihre momentanen<br />
Bedürfnisse gut ausdrücken und<br />
auch ein einfaches, kurzes Gespräch mit ihr<br />
ist möglich.<br />
3. Eine neue Idee – Der Einsatz<br />
von GuK in meiner Klasse<br />
Im September 2006 nahm ich im Rahmen<br />
der 2. Österreichischen <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong>-<br />
Tagung in Salzburg am Workshop „Gebärdenunterstützte<br />
Kommunikation“ von Frau<br />
Prof. Dr. Etta Wilken teil. Da ich schon im<br />
Jahr davor aus persönlichem Interesse heraus<br />
mit einem ÖGS-Kurs begonnen hatte,<br />
interessierte mich diese Methode der unterstützten<br />
Kommunikation sehr.<br />
Obwohl Prof. Dr. Wilken diese Methode<br />
für jüngere Kinder entwickelte, wollte<br />
ich versuchen, die gebärdenunterstützte<br />
Kommunikation im Unterricht mit meinen<br />
Schülern/-innen anzuwenden. Durch meinen<br />
Gebärdensprachkurs hatte ich bereits<br />
einen guten Grundwortschatz erworben,<br />
der es mir ermöglichte, einige Basisgebärden<br />
der ÖGS an meine Schüler/-innen weiterzugeben.<br />
Die Gebärden und den Wortschatz<br />
wählte ich nach der Bedeutung für<br />
die Kinder oder unseren Wochenthemen<br />
aus.<br />
Das von Frau Prof. Dr. Wilken entwickelte<br />
Arbeitsmaterial für den Einsatz von<br />
GuK verwendete ich nicht, da es sich dabei<br />
um Gebärden der Deutschen Gebärdensprache<br />
(DGS) handelt. Ich stellte selbst<br />
Bild- und Wortkarten für meine Schüler/<br />
-innen her. Anders als beim Arbeitsmaterial<br />
von Frau Prof. Dr. Wilken benutzte ich<br />
jedoch keine Bilder der Gebärden, sondern<br />
zeigte den Kindern die Gebärden immer<br />
wieder selbst. Ein selbstständiges Lernen<br />
der Kinder mit dem Material war in diesem<br />
Fall nicht möglich. Die meisten Kinder<br />
merkten sich die Gebärden dennoch<br />
erstaunlich schnell und benötigten nur wenige<br />
gezielte Übungen zur Festigung.<br />
Didaktische Überlegungen zum<br />
Einsatz von GuK<br />
Zu Beginn verwendete ich fast ausschließlich<br />
Nomen. Diese Gebärden konnte ich auf<br />
einfache Weise mit Bildern, Gegenständen<br />
oder Hinzeigen verknüpfen. Die ersten Gebärden,<br />
die ich den Kindern zeigte, waren<br />
die Namen der Farben.<br />
Dann folgten die Namen der Verkehrsmittel,<br />
die wir bei unseren Ausfl ügen verwenden,<br />
die Namen täglich gebrauchter<br />
Schulsachen und Gegenstände im Raum<br />
(Musik, Computer, Spielsachen, …).<br />
Natürlich auch sehr wichtige Wörter wie<br />
Mama, Papa, Oma, Opa, Kind, Haus, Auto,<br />
Baum, Ball, Rad, Danke, Bitte, usw.<br />
Ich grenzte dabei die Auswahl nicht bewusst<br />
ein, sondern zeigte den Kindern Gebärden,<br />
wenn ich merkte, dass ein bestimmter<br />
Begriff im Alltag der Kinder von<br />
Bedeutung war oder das Verstehen dadurch<br />
erleichtert wurde.<br />
Die ersten Verben, die die Kinder kennenlernten,<br />
waren zum Teil natürliche Gebärden,<br />
wie z.B. essen, trinken, anziehen,<br />
…<br />
Darauf folgten Verben der ÖGS wie arbeiten,<br />
spielen oder lesen, die wir gemeinsam<br />
erarbeiteten.<br />
Einen Großteil der Gebärden nahmen<br />
die Kinder durch reines Beobachten auf.<br />
Adjektive wie z.B. groß, schnell oder laut<br />
nahmen die Kinder durch das Beobachten<br />
meiner Erklärungen im Alltag in ihren<br />
Wortschatz auf, ohne dass sie dafür eine<br />
konkrete Erarbeitung benötigten.<br />
Wichtige Adjektive im Schulalltag meiner<br />
Klasse sind: groß, klein, leise, laut, brav,<br />
schnell, langsam, viel, schön, gut, schwer,<br />
leicht, traurig, lustig, spannend, …<br />
Ebenso verwendete ich einige abstrakte<br />
Begriff e „nebenher“ bei Erklärungen und so<br />
wurden auch diese zu einem fi xen Bestandteil<br />
des passiven Wortschatzes der Kinder.