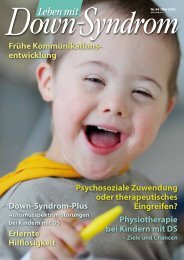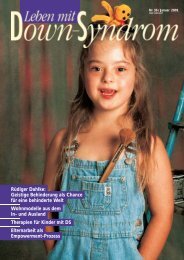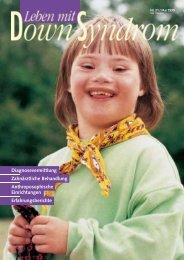Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
� � SPRACHE<br />
Zweisprachigkeit bei Kindern<br />
mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> TEXT: JOHANNE OSTAD<br />
Die Autorin, Leiterin des Fremdsprachenzentrums in Halden (Norwegen), schrieb ihre Dissertation zum<br />
Thema Zweisprachigkeit bei Kindern mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong>. Aus dieser 2006 fertiggestellten Arbeit – die<br />
Familien, die sich an der Studie beteiligten, wurden damals über die Zeitschrift Leben mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong><br />
gefunden – wurde bereits in einer früheren Ausgabe dieser Zeitschrift ein erster Teil über die Kommunikationsfähigkeit<br />
der Kinder mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> veröff entlicht.<br />
Dieser Artikel berichtet unter anderem über die Erfahrungen, die Familien mit der zweisprachigen Erziehung<br />
gemacht haben, über die Vorteile, die eine Mehrsprachigkeit – auch für Kinder mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong><br />
– mit sich bringt, sowie über die Vorurteile, mit den sich Eltern, deren Kinder zweisprachig aufwachsen,<br />
häufi g auseinandersetzen müssen.<br />
Wenn untersucht werden soll, ob Kinder mit<br />
<strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> zweisprachig aufwachsen<br />
können, muss genau defi niert sein, was unter<br />
Zweisprachigkeit zu verstehen ist. Weiter<br />
müssen Konsequenzen der Zweisprachigkeit<br />
dargelegt werden bzw. muss erörtert werden,<br />
wie sich das Leben mit zwei Sprachen<br />
gestaltet und welche Faktoren einen Einfl<br />
uss auf diese Form der Erziehung haben<br />
können. Dabei muss zwischen populären<br />
„Wahrheiten“, die sowohl von Fachleuten als<br />
auch Laien proklamiert werden, und wissenschaft<br />
lich fundierten Th esen unterschieden<br />
werden. Besonders bei der Sprachentwicklung<br />
geistig und körperlich benachteiligter<br />
Kinder ist es gefährlich, derartige Behauptungen<br />
als Wahrheiten zu reproduzieren,<br />
ohne den Wahrheitsgehalt oder die Wissenschaft<br />
lichkeit nachzufragen.<br />
Begriff serklärung – Was versteht man<br />
unter Zwei- oder Mehrsprachigkeit?<br />
Zum Begriff „Individuelle Zwei- oder<br />
Mehrsprachigkeit/individueller Bilingualismus“<br />
gibt es fast so viele Defi nitionen wie<br />
Beiträge zum Th ema. Der vorliegenden Untersuchung<br />
liegt die Auff assung Grosjeans<br />
zu-grunde. Grosjean (1995: 259) bezeichnet<br />
Personen als bilingual, die zwei oder<br />
mehrere Sprachen oder Dialekte im täglichen<br />
Leben verwenden. Er behauptet allerdings,<br />
dass die bilingualen Sprecher selten<br />
gleich oder vollständig fl ießend beide<br />
Sprachen beherrschen, da der Bedarf sowie<br />
der Gebrauch der Sprachen oft ganz unterschiedlich<br />
ist.<br />
Nach Mahlstedt bilden zweisprachige<br />
Kinder in der Regel eine starke und eine<br />
schwache Sprache aus, wobei die starke<br />
normalerweise mit der Umgebungsspra-<br />
30 Leben mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>58</strong> I <strong>Mai</strong> 2008<br />
che identisch ist (Mahlstedt 1996: 20). Und<br />
Döpke stellt fest, dass auch Kinder, die nur<br />
eine der Familiensprachen verwenden, als<br />
bilingual zu bezeichnen sind, sofern das<br />
Verständnis beider Sprachen vorhanden ist.<br />
Erfahrungen zeigen, dass diese sogenannte<br />
rezeptive Mehrsprachigkeit schnell aktiviert<br />
werden kann. Das passiert, wenn das Kind<br />
die Notwendigkeit beider Sprachen erfährt,<br />
z.B. im Falle einer Änderung des sprachlichen<br />
Umfeldes (nach Döpke 1992: 3).<br />
Durch diese Erkenntnisse wird die Defi -<br />
nition von Grosjean zur Mehrsprachigkeit<br />
nochmals untermauert.<br />
Die mehrsprachige Erziehung<br />
Triarchi-Herrmann (2003: 110 ff .) hat folgende<br />
Faktoren für eine erfolgreiche mehrsprachige<br />
Erziehung aufgestellt. Sie nennt<br />
fünf Prinzipien, auf die mehrsprachige Familien<br />
zu achten haben. An erster Stelle<br />
steht dabei die Menge an Input. Triarchi-<br />
Herrmann zufolge müssen Eltern so viel<br />
wie möglich mit dem Kind sprechen. Weiter<br />
empfi ehlt sie den Eltern, dem Prinzip<br />
une personne/une langue zu folgen, Sprachmischungen<br />
zu vermeiden, die Wichtigkeit<br />
beider Sprachen innerhalb der Familie zu<br />
betonen und schließlich dem Kind eine positive<br />
Einstellung zu den zwei Sprachen zu<br />
vermitteln.<br />
Bezüglich der Konsequenzen einer<br />
mehrsprachigen Erziehung gibt es unterschiedliche<br />
Th eorien. In älteren Forschungsberichten<br />
wurden vorwiegend die<br />
negativen Aspekte der kognitiven Fähigkeiten<br />
bilingualer Kinder hervorgehoben.<br />
Bilinguale Kinder wären weniger intelligent,<br />
lernten später sprechen, würden stottern<br />
und riskierten sogar, schizophren zu<br />
werden. Sie würden keine Sprache richtig<br />
lernen und somit semilingual werden. Aus<br />
diesem Grund haben viele Eltern Angst,<br />
ihre Kinder mehr als einer Sprache „auszusetzen“.<br />
Sie befürchten, ihr Kind könnte<br />
semilingual/doppelt halbsprachig werden<br />
(Lanza 1997: 4).<br />
Ein weiterer vermeintlicher Nachteil bilingualer<br />
Sprecher, verglichen mit den Monolingualen,<br />
ist ein verzögerter Spracherwerb.<br />
Tracy/Gawlitzek-<strong>Mai</strong>wald (2000: 519)<br />
nennen diese Behauptung ein Vorurteil und<br />
weisen auf neuere Forschungen hin, die<br />
eine derartige Hypothese nicht bestätigen.<br />
Überhaupt wird in neuerer Forschung den<br />
schon erwähnten negativen Auswirkungen<br />
widersprochen.<br />
Grosjean bemerkt, dass Bilinguale ihre<br />
eigene Zweisprachigkeit als einen Vorteil<br />
sehen und Probleme in dieser Hinsicht<br />
meis-tens von Monolingualen konstruiert<br />
wurden (Grosjean 1982: 268). Auch andere<br />
Linguisten sind von den positiven Auswirkungen<br />
einer mehrsprachigen Erziehung<br />
überzeugt.<br />
Neurolinguistische Untersuchungen der<br />
letzten Jahre scheinen die positiven Auswirkungen<br />
zu bestätigen. Eine in Basel<br />
ansässige Forschungsgruppe zur „Mehrsprachigkeit<br />
im Gehirn“ hat die Gehirnaktivität<br />
vielsprachiger Probanden beobachtet<br />
und eine entscheidende Erkenntnis<br />
lautet: „Erlernt man zwei oder mehr Sprachen<br />
früh, verwendet das Gehirn andere,<br />
für die Beherrschung mehrerer Sprachen<br />
tendenziellgünstigere Strategien,<br />
als wenn man nur mit einer Sprache aufwächst“<br />
(aus Kramer 2003). Die sogenannte<br />
magische Altersgrenze scheint bei drei<br />
Jahren zu liegen – wenn die verschiedenen