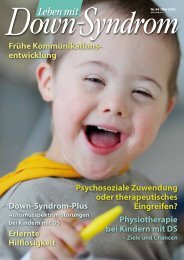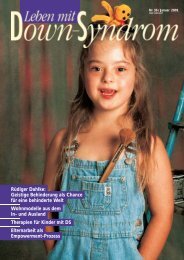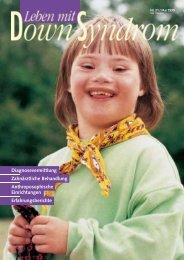Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� � PSYCHOLOGIE<br />
Anlass „normale“ Welt „behinderte“ Welt<br />
Geburt Feier kein Ritual – Schock für die Eltern<br />
Geburtstag Feier Ritual, aber Erinnerung an Schock<br />
Sauberkeit Positive Konnotation kein Ritual – oft verspätet<br />
Pubertät/Sexualität Aufklärung kein Ritual<br />
Schulabschluss/ Feier Abschluss Ritual<br />
Aufnahme in WfbM<br />
Aufnahme in WfbM kein Ritual<br />
Erwachsen werden Auszug kein Ritual – immer Kind<br />
Familie/Heirat Feier kein Ritual – selten Segnung<br />
Führerschein Positive Konnotation kein Ritual<br />
Umzug Feier selten Ritual<br />
ternteil würde auf die Idee kommen, dass das eigene Kind beerdigt<br />
werden muss, um selbst beruhigt sterben zu können.<br />
Im Behindertenbereich gibt es für diesen Lebensübergang<br />
kein kulturell vorgegebenes Verhaltensmuster. Kein Elternteil<br />
kann andere Eltern fragen, wie sie das bewältigt haben; vor<br />
allem „gut“ bewältigt haben. Es gibt keine Tradition. Wollten wir<br />
also diesen Familien helfen, den Übergang zu schaffen, so wäre<br />
es notwendig, ein Ritual zu gestalten, das eine Vorbereitungszeit<br />
beinhaltet: Abschied, Erinnerung, gemeinsame Erlebnisse,<br />
Dankbarkeit, Trauer, der Gedanke: Wie wird es weitergehen? Das<br />
könnte die Zeit der Entwicklung des Rituals sein, mit einem symbolischen<br />
Akt und einer Zeit der Integration in die neuen Lebensumstände.<br />
Alle drei Phasen müssen in ausreichendem Maß berücksichtigt<br />
werden. Keine darf ausgelassen werden. Unter allen Umständen<br />
aber müsste das Ritual einen symbolischen Akt beinhalten,<br />
der kurz und emotional „mächtig“ das Ereignis komprimiert;<br />
meist im Rahmen einer Feier oder eines Festes. Die Angst machenden/traurigen<br />
und die freudigen/zukünftigen Optionen<br />
werden ausgesprochen.<br />
Mutter: „Es ist sehr traurig, dich nicht mehr bei mir zu haben! Es<br />
ist entlastend, wenn ich nicht immer auf dich aufpassen muss.“<br />
Sohn: „Es ist schön, neue Freunde um mich zu haben. Es ist schade,<br />
dass ich die Schuhe nicht mehr geputzt bekomme.“<br />
Diese oder ähnliche Sätze müssten innerhalb eines Rituals<br />
tatsächlich auch ausgesprochen werden, sonst können sie ihre<br />
emotionale Wirkung nicht entfalten. Analog: „Ja, ich will“ bei der<br />
Hochzeit.<br />
Das scheint mir auch der Punkt zu sein, an dem die Macht normativer<br />
Rituale nicht genutzt wird. So zu verfahren setzt voraus,<br />
sich mit den Betroffenen über einen längeren Zeitraum hinweg<br />
zu beschäftigen, ihnen die Bedeutsamkeit eines Rituals nahezubringen<br />
und mit ihnen zusammen die genau passenden Worte<br />
zu entwickeln und sie auch rituell in einer feierlichen Atmosphäre<br />
vor Zeugen sagen zu lassen.<br />
Reaktionen wie „Da komme ich mir doch blöd vor!“ sind zu erwarten.<br />
Ein Verständnis zu entwickeln und entsprechend zu handeln<br />
wird sicherlich von Seiten der professionellen Begleitung<br />
dieses Übergangs erwartet werden müssen. Die Eltern sind mit<br />
der Entwicklung solcher Rituale überfordert. Sie müssen individuell<br />
an die Gegebenheiten der einzelnen Beteiligten angepasst<br />
werden. Neben der Gestaltung der rituellen Handlung wären die<br />
Vorbereitungen im Sinne von Besuchen, Absprachen und Vertragsverhandlungen,<br />
Einrichtung des neuen Zuhauses u.Ä. und<br />
18 Leben mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>58</strong> I <strong>Mai</strong> 2008<br />
auch der integrativen Aspekt nachher zu bearbeiten.<br />
Was tun die Mitbewohnerinnen und die Mitarbeiterinnen, um<br />
die Eingliederung zu erleichtern (Übergabe der Hausordnung,<br />
Einführung und Vorstellung in der neuen Umgebung u.Ä.)? Was<br />
nimmt die Bewohnerin von zu Hause mit und was symbolisiert,<br />
dass sie immer noch die Tochter, das Kind der Eltern ist (z.B. ein<br />
bedeutsamer Gegenstand, der das Elternhaus darstellt)? Was behalten<br />
die Eltern oder bekommen die Eltern von der Tochter, das<br />
die Anwesenheit im Elternhaus symbolisieren kann? Dies alles<br />
gipfelt in einem Fest, das wirklich bewegend sein sollte. Musik,<br />
Bewegung und Tanz ebenso wie Platz für Tränen, Freude und Essen.<br />
So könnte ein Abschiedsritual als gestaltetes normatives Ritual<br />
im Entwurf aussehen. So könnte der Übergang markiert und<br />
nach außen hin deutlich gemacht werden. Jetzt ist eine neue<br />
Zeit und jetzt gelten andere Regeln in einer anderen Subkultur<br />
als der familiären.<br />
Therapeutische Rituale sind eine Sonderform normativer Rituale.<br />
Im Grunde ist der Unterschied im Setting entscheidend,<br />
denn hier wird das Ritual vom System (z.B. der Familie) mithilfe<br />
der Therapeutin angeregt, ein geeignetes Ritual zu entwickeln,<br />
um fehlgelaufene oder unvollständige normative Rituale aus der<br />
Geschichte des Systems im Nachhinein zu korrigieren.<br />
Alltägliche Rituale<br />
Tabelle 1: Vergleich „normale“<br />
und „behinderte“ Welt<br />
Diese Form des Handelns hat in der Wiederholung die entscheidende<br />
Größe. Alltagsrituale sind strukturbildend. Neurobiologisch<br />
sind diese Handlungsabläufe mit der Bildung eines „cellassembly“<br />
vergleichbar; also eingeprägt/gelernt – und damit<br />
immer wieder reproduzierbar. Ein typisches alltägliches Ritual ist<br />
etwa das immer gleich ablaufende Frühstücksritual. Jeden Tag<br />
ein Mal gemacht – aber wehe, die Zahnpasta-Tube oder der Kaffee<br />
steht an einem anderen Platz.<br />
Der Tag ist „gelaufen“, wir sind irritiert, es stimmt „nichts“ mehr.<br />
Während wir keinerlei Probleme haben, uns in fremder Umgebung<br />
aus dem Waschbeutel zu versorgen oder den Kaffee im Hotel<br />
aus der Warmhaltekanne trotz all dem zu genießen.<br />
„Rituale (...) gelten nunmehr als ,Routinisierung‘, sie sind nun<br />
die Formen der Alltagsbewältigung, mit denen wir, regelmäßig gepfl<br />
egt und wiederholt, unsere Existenz sichern.“ (Bliersbach 2004<br />
S. 26)<br />
Es handelt sich bei den ritualisierten Alltagshandlungen möglicherweise<br />
auch um „leere“ ehemals normative Rituale. Sie sind