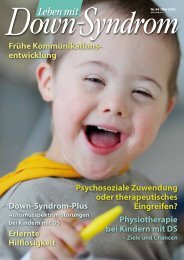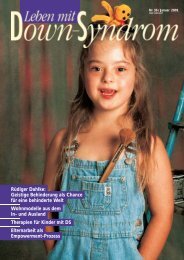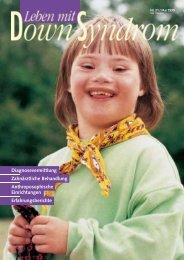Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� � NACHDENKLICHES<br />
„Deppen werden geduzt“?<br />
Wer Teilhabe sagt, muss auch Sie sagen<br />
TEXT: THOMAS SCHRECKER<br />
Ein junger Mann sitzt im roten Linienbus. Er begrüßt viele Leute<br />
freundlich, der Busfahrer sagt zu ihm: „Guten Morgen, Moritz!“ Auch<br />
die anderen Pendler kennen „Moritz“ schon. Er fällt auf und ist anders,<br />
er ist ein junger Mann mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong>. Keiner kennt seinen<br />
Nachnamen ...<br />
„Moritz“ ist jetzt 20 Jahre alt. Er will seit einiger Zeit selbst mit öffentlichen<br />
Bussen fahren und ist auch ziemlich stolz darauf. Vor der<br />
Schule für geistig behinderte Kinder und Jugendliche in Heitersheim<br />
begrüßt ihn sein Lehrer, Herr Müller: „Guten Morgen, Moritz! Hat bei<br />
dir alles geklappt?“, und bekommt zur Antwort: „Herr Müller, kannst<br />
du mir sagen, wie ich mit dem Bus nach Freiburg fahren kann? Ich<br />
will dort meine Schwester besuchen.“ „Aber klar“, antwortet Herr<br />
Müller, „das zeige ich dir.“<br />
Höfl ichkeitsregeln an Schulen<br />
für geistig Behinderte<br />
Die Schüler und Schülerinnen an Schulen<br />
für geistig Behinderte werden in aller Regel<br />
bis zu ihrer späten Entlassung – manchmal<br />
erst mit 24 Jahren – von ihren Lehrerinnen<br />
und Lehrern bzw. Betreuerinnen und Betreuern<br />
geduzt und sprechen diese häufi g<br />
mit „Du, Herr Müller“ an. Oft lernen sie in<br />
schulischen Zusammenhängen kaum ihren<br />
Nachnamen kennen, übliche Höfl ichkeitsregeln<br />
sind, im Gegensatz zu anderen Verhaltensnormen,<br />
nicht Unterrichtsgegenstand.<br />
Der beschützte Raum der Schule für geis-<br />
tig Behinderte öff net sich jetzt, zum Beispiel<br />
durch Projekte: „Integration auf dem ersten<br />
Arbeitsmarkt“, das erfordert diff erenzierte<br />
Lerninhalte, die den Anforderungen der<br />
„Welt draußen“ entsprechen, und das erfordert<br />
das Wissen, Menschen siezen zu können.<br />
In der Welt der<br />
Nichtbehinderten ...<br />
Gegenseitige Ehrerbietung oder<br />
Vertrautheit<br />
Unter Erwachsenen wird die Höfl ichkeitsform<br />
normalerweise gegenseitig verwendet.<br />
Die einseitige Verwendung des Duzens<br />
gilt oft als unhöfl ich und als „Verweigerung<br />
<strong>58</strong> Leben mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>58</strong> I <strong>Mai</strong> 2008<br />
der Ehrerbietung“ oder sie ist Ausdruck<br />
eines sozialen Unterschieds. So werden<br />
Menschen, die einfache Tätigkeiten ausüben,<br />
von Höherstehenden geduzt. Die Ursache<br />
hierfür dürft e sein, dass früher Adel<br />
und Klerus das gemeine Volk geduzt haben,<br />
das umgekehrt die Höfl ichkeitsform benutzen<br />
musste.<br />
Kinder werden geduzt<br />
Generell gilt für Kinder, alle Erwachsenen<br />
mit Ausnahme der eigenen Familie und Erwachsener<br />
aus dem Bekanntenkreis zu siezen,<br />
während Kinder normalerweise von<br />
niemand gesiezt werden.<br />
Die Anwendung der Höfl ichkeitsform<br />
ist dabei anfangs ein sich entwickelnder<br />
Prozess: An Grundschulen ist es in der Regel<br />
noch üblich, dass die Kinder ihre Lehrerinnen<br />
und Lehrer zwar mit „Herr“ oder<br />
„Frau“ plus Familienname anreden, aber<br />
dennoch das „Du“ verwenden („Du, Frau<br />
Müller, kannst du mir mal sagen, wie ich die<br />
Aufgabe lösen kann?“). Spätestens ab der<br />
Sekundarstufe II werden aber alle Schülerinnen<br />
und Schüler von ihren Lehrerinnen<br />
und Lehrern gesiezt. In der Regel werden<br />
sie beim Vornamen genannt.<br />
Hierarchie in der Berufswelt<br />
In der Berufswelt kennzeichnet das ungleichzeitige<br />
„Siezen“ vs. „Duzen“ eindeutige<br />
hierarchische Machtstrukturen: Der<br />
Chef wird in der Regel von allen gesiezt.<br />
Kolleginnen und Kollegen, die auf gleicher<br />
Ebene in der Betriebshierarchie stehen, duzen<br />
sich. Auch Antipathien innerhalb des<br />
Kollegiums werden durch das Siezen gekennzeichnet.<br />
Ein einmal verabredetes<br />
„Du“ kann bei Konfl ikten und Abgrenzungstendenzen<br />
wieder zum „Sie“ umfunktioniert<br />
werden. Die Du-Form kann also<br />
Nähe und Vertraulichkeit ausdrücken. Die<br />
Sie-Form kann im Gegensatz dazu Distanz<br />
und Förmlichkeit, aber auch Respekt signalisieren.<br />
Ebenfalls kann über ein „Du“ auch<br />
eine Dominanz angezeigt werden, wenn der<br />
„Höhere“ den „Niedereren“ duzt und der<br />
„Niederere“ den „Höheren“ zu siezen hat,<br />
wie vielleicht der Lehrling den Chef ...<br />
Fehlenden Respekt kann man auch daran<br />
erkennen, wenn Menschen mit schlechten<br />
Deutschkenntnissen beinahe automatisch<br />
geduzt werden.<br />
Duzen als Beleidigung<br />
Der herablassende Beiklang des Duzens<br />
(von oben nach unten) kann durchaus als<br />
gezielte Unhöfl ichkeit benutzt werden. Juristisch<br />
wird dementsprechend von deutschen<br />
Gerichten ein nicht ausdrücklich<br />
erlaubtes Duzen als Beleidigung gewertet,<br />
auch bei Privatpersonen und nicht nur<br />
dann, wenn Amtsträger wie beispielsweise<br />
Verkehrspolizisten geduzt werden. Doch<br />
wird dieses Vergehen, wie alle Formen der<br />
Beleidigung, nur auf Antrag des Beleidigten<br />
strafrechtlich verfolgt.<br />
Höfl ichkeitsgrenze Intelligenz?<br />
Viele dieser Regeln scheinen in der Behindertenpädagogik<br />
nicht zu gelten. Haben die<br />
üblichen Formen der Höfl ichkeit vielleicht<br />
eine IQ- Schranke? Denn wir erleben in unserem<br />
Alltag im Umgang mit Menschen mit<br />
einer geistigen Behinderung nicht, dass das<br />
Alter für die Anrede ausschlaggebend ist.<br />
Orientieren wir uns also am Grad der<br />
kognitiven Einschränkung oder der „Bedürft<br />
igkeit“? Löst das „kindliche“ Verhalten<br />
diesen irrtümlichen Refl ex bei uns aus?<br />
Der geistig behinderte Moritz wird als<br />
„Moritz“ geboren, als „Moritz“ verbringt er<br />
die Schulzeit, als „Moritz“ wechselt er in die<br />
Werkstatt für behinderte Menschen und als