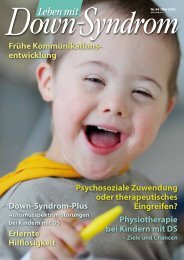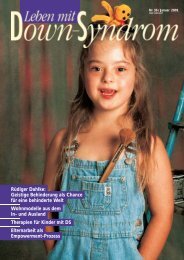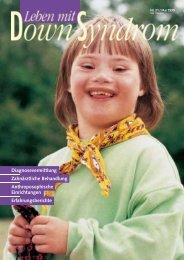Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Moritz“ wird er alt werden.<br />
Steht am Ende sogar in seiner Todesanzeige<br />
„Moritz“?<br />
Stigmatisierung durch<br />
Sprache<br />
Wenn der Mensch mit einer geistigen Behinderung<br />
erwachsen wird, bemerkt die<br />
Umwelt nicht nur an seinem Verhalten<br />
und an seinem anderen Äußeren, dass er/<br />
sie anders ist. Die allgemein gültigen Höflichkeitsregeln<br />
scheinen für ihn/sie nicht zu<br />
gelten. Selbst kleine Kinder merken schnell<br />
– auch an diesen Umgangsformen –, wann<br />
jemand nicht der Norm entspricht.<br />
„Moritz“ selbst kennt es nicht anders.<br />
Er fällt auf: Der Busfahrer, der Bäcker, der<br />
Metzger und der Brieft räger, alle werden<br />
von ihm geduzt und alle erkennen auch daran<br />
sofort, dass es sich nicht nur um einen<br />
Menschen handelt, der „anders“ ist, sondern<br />
der ganz off enbar so eine einfache Sache<br />
nicht lernen kann.<br />
Die Schule für geistig<br />
Behinderte ist auch anders ...<br />
Während in der sonstigen Schulwelt ab 16<br />
Jahren die Schülerinnen und Schüler von<br />
den Lehrerinnen und Lehrern gesiezt werden,<br />
ist es in den Schulen für geistig Behinderte<br />
seit mehr als 30 Jahren verbreitete<br />
Praxis (Ausnahmen bestätigen die Regel),<br />
die Schüler/-innen bis zu ihrer Entlassung<br />
zu duzen.<br />
... Warum?<br />
Auch der Paradigmenwechsel der Normalisierung<br />
und des Empowerment (weg vom<br />
Beschützen und Umsorgen hin zu einem<br />
selbstständigen Leben in sozialer Integration)<br />
haben in der Behindertenarbeit bis jetzt<br />
nicht dazu geführt, dass die Regeln der allgemeinen<br />
Höfl ichkeit überall auf die jungen<br />
Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung<br />
angewandt werden.<br />
Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig<br />
und es lohnt sich, diese genauer anzuschauen:<br />
1. Kindliches Verhalten wird geduzt<br />
Menschen, die langsamer oder vollkommen<br />
anders denken und sich artikulieren<br />
(kognitive Einschränkungen) und durch<br />
ihr oft kindlich wirkendes Verhalten (Entwicklungsverzögerungen)<br />
scheinbar nie erwachsen<br />
werden und mehr den Kindern<br />
zuzuordnen sind, sind dem „Du“ näher als<br />
dem „Sie“.<br />
In unserem Kulturkreis scheinen wir geradezu<br />
darauf konditioniert zu sein, dass<br />
alle, die sich scheinbar kindlich artikulieren,<br />
geduzt werden.<br />
Kennen Sie nicht auch Diskussionen zu<br />
diesem Th ema in Pfl egeheimen, in denen es<br />
oft auch unrefl ektierte Praxis ist, demente<br />
Bewohnerinnen und Bewohner zu duzen?<br />
Wir postulieren Teilhabe und „ernst<br />
nehmen“ der Menschen mit einer geistigen<br />
Behinderung und duzen munter weiter ...<br />
2. Beziehungsarbeit erfordert Nähe<br />
Behindertenarbeit ist Beziehungsarbeit. Erst<br />
das Einbringen der eigenen Persönlichkeit<br />
in den Arbeitsalltag lässt sonderpädagogisches<br />
Arbeiten möglich werden. Die/der<br />
Pädagogin/Pädagoge muss viel „Herzblut“<br />
investieren, um emotional an die Schülerinnen<br />
und Schüler mit Behinderung überhaupt<br />
heranzukommen.<br />
Hier spielt die Sprache eine große Rolle<br />
und wir müssen uns die Frage nach der<br />
distanzierenden Wirkung eines „Sie“ gefallen<br />
lassen:<br />
Entfernt also das Siezen nicht Menschen<br />
voneinander, die oft auf ganz einfachen basalen<br />
Ebenen miteinander interagieren?<br />
Beziehen wir aber die Regeln der allgemeinen<br />
Höfl ichkeit wieder mit ein, und gehen<br />
von Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung<br />
in der Beziehung aus, dann müssten<br />
sich beide Partner beim Vornamen nennen<br />
und duzen. Das ist aber nicht der Fall. Die<br />
Lehrerin bzw. der Lehrer – die nicht behinderte<br />
Respektsperson – stellt sich den<br />
behinderten Schülerinnen und Schülern<br />
schon mit „Ich bin die Frau <strong>Mai</strong>er“ vor. Das<br />
ist eingespielt und die Behinderten fi nden<br />
es dann auch vollkommen normal, „Du,<br />
Frau <strong>Mai</strong>er“ zu sagen.<br />
3. Ein Missverständnis aus Gewohnheit<br />
Alte Muster in unseren Köpfen bestimmen<br />
unseren Arbeitsalltag und den Umgang mit<br />
geistig behinderten Menschen.<br />
Vieles in der Welt der Sonderpädagogik<br />
ist lange eingespielt. Gewohnheiten werden<br />
nicht ständig hinterfragt und refl ektiert.<br />
4. Lernchancen verpasst?<br />
Wenn die Reden von sozialer Integration<br />
oder gar Inklusion über Sonntagsreden hinaus<br />
Bestand haben sollen, sollten die jungen<br />
Erwachsenen dann nicht die Möglichkeit<br />
haben, gesellschaft lich gesetzte Regeln<br />
der Höfl ichkeit zu erfahren, zu erleben und<br />
– vor allem in der Schule – zu erlernen?<br />
Sollen die Grenzen des sprachlichen<br />
Umgangs wirklich an der Intelligenz und an<br />
� � NACHDENKLICHES<br />
der Entwicklung der jeweiligen Person festgemacht<br />
werden?<br />
Bestimmt ist es viel verlangt, Schülerinnen<br />
und Schülern den gebotenen Respekt<br />
auch in dieser sprachlichen Form zu<br />
erweisen, die ihrerseits Mühe haben, Lehrerinnen<br />
und Lehrern Respekt entgegenzu-<br />
bringen.<br />
Aber gerade hier lägen große Lernchancen<br />
für Schülerinnen bzw. Schüler mit Behinderung<br />
und Chancen für uns, unsere eigene<br />
Ernsthaft igkeit zu beweisen!<br />
„Du“-Diskussion dringend<br />
notwendig<br />
Es ist höchste Zeit, dass<br />
��� Lehrkräft e ihre gewohnte Praxis der<br />
Anrede refl ektieren<br />
��� Auseinandersetzungen in Kollegien begonnen<br />
werden<br />
��� Referendarinnen und Referendare in<br />
den Ausbildungsseminaren die Bildung<br />
von erwachsenen Schülerinnen und<br />
Schülern refl ektieren<br />
��� auch in der Berufswelt (Wfb M) die täglich<br />
benutzten Umgangsformen hinterfragt<br />
werden.<br />
Denn eines ist sicher:<br />
Wir müssen im Mikrokosmos der „Behindertenszene“<br />
mit dem Umdenken beginnen,<br />
sonst wird in der Welt der Nichtbehinderten<br />
für immer weiterhin gelten:<br />
„Deppen werden geduzt.“�<br />
Thomas Schrecker<br />
Fachlehrer für geistig Behinderte<br />
Leben mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>58</strong> I <strong>Mai</strong> 2008 59