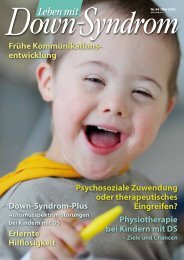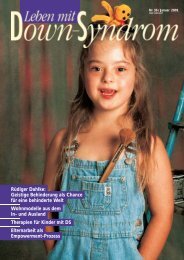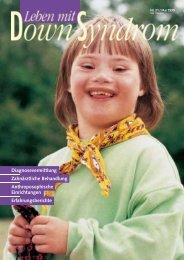Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Nr. 58 I Mai - Deutsches Down-Syndrom InfoCenter
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
� � SPRACHE<br />
später sprechen lernen sollten, beeinfl usst<br />
dies nicht ihren Umgang mit den beiden<br />
Sprachen.<br />
Die Geschwisterstellung oder überhaupt<br />
das Vorhandensein von Geschwistern könn-<br />
te die Sprachentwicklung beeinfl ussen. In<br />
dieser Umfrage haben 14 der 19 Kinder<br />
Geschwister. Vier haben ältere Geschwister,<br />
neun jüngere und ein Kind hat sowohl<br />
ältere als auch jüngere Geschwister. Die<br />
Kinder, die keine Geschwister haben, haben<br />
durchschnittlich mit 1,5 angefangen<br />
zu sprechen, die mit älteren Geschwistern<br />
mit 1,8. In der ersten Gruppe befi nden sich<br />
zwei Mädchen und drei Jungen, also kann<br />
das Geschlecht das Ergebnis kaum beeinfl<br />
ussen. In der zweiten Gruppe befi nden<br />
sich zwei Jungen und zwei Mädchen, also<br />
kann der Faktor Geschlecht auch hier nicht<br />
bedeutend sein.<br />
Die Gruppe mit jüngeren Geschwistern,<br />
bestehend aus sechs Mädchen und zwei<br />
Jungen, hat durchschnittlich mit 2,0 angefangen<br />
zu sprechen. Dies gilt ebenso für einen<br />
Junge, der als Einziger sowohl jüngere<br />
als auch ältere Geschwister hat.<br />
Die Kinder mit älteren Geschwistern<br />
können sich in zwei Fällen gut in beiden<br />
Sprachen ausdrücken, in einem Fall gut in<br />
der Sprache des Vaters. In einem Fall ist<br />
das Kind verständlich für die Familie in<br />
der Sprache des Vaters und in der Sprache<br />
der Mutter auch für die Familie schwer verständlich.<br />
Die Kinder ohne Geschwister können<br />
sich in zwei Fällen gut in beiden Sprachen<br />
ausdrücken, in einem Fall gut in der Sprache<br />
des Vaters (für die Sprache der Mutter fehlt<br />
die Angabe) und in zwei Fällen in beiden<br />
Sprachen gut für die Familie verständlich.<br />
Keines der Kinder mit nur jüngeren Geschwistern<br />
kann sich in beiden Sprachen<br />
gut ausdrücken. Drei von ihnen können<br />
sich in einer Sprache gut ausdrücken und<br />
in der anderen Sprache jeweils einmal gut<br />
für die Familie, einmal schwierig auch für<br />
die Familie und einmal schlecht. Drei können<br />
sich in beiden Sprachen für die Familie<br />
gut ausdrücken und ein Kind kann sich in<br />
beiden Sprachen auch für die Familie nur<br />
schwer verständlich ausdrücken.<br />
Die Ergebnisse lassen die vorsichtige<br />
Schlussfolgerung zu, dass es für ein Kind<br />
mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> hilfreicher ist, ältere<br />
Geschwister zu haben oder Einzelkind zu<br />
sein, als jüngere Geschwister zu haben.<br />
Durch den Besuch einer öffentlichen<br />
Einrichtung erwirbt ein Kind mit <strong>Down</strong>-<br />
<strong>Syndrom</strong> soziale Kompetenzen und ver-<br />
36 Leben mit <strong>Down</strong>-<strong>Syndrom</strong> <strong>Nr</strong>. <strong>58</strong> I <strong>Mai</strong> 2008<br />
bessert seine Sprache, so berichten viele Eltern.<br />
15 der 19 Kinder besuchen eine öff entliche<br />
Einrichtung. Ein Kind geht ab 2005 in<br />
den Regelkindergarten. Zwei Kinder haben<br />
ihre Schulzeit in einer Geistigbehindertenschule<br />
bzw. in Sonderschulen verbracht. Da<br />
fast alle Kinder eine oder mehrere öff entliche<br />
Einrichtung/en besuchen, kann hier<br />
kein Vergleich gezogen werden.<br />
Das Bildungs- und Einkommensniveau<br />
der Eltern wird in der Literatur wiederholt<br />
als entscheidender Faktor für die Sprachentwicklung<br />
der Kinder gewertet. Mahlstedt<br />
und Saunders bestreiten dies für den Fall<br />
mehrsprachiger Familien und nennen Motivation<br />
und Engagement als die entscheidenden<br />
Faktoren.<br />
Die Eltern dieser Umfrage haben eine<br />
durchschnittlich hohe Bildung. Mit Ausnahme<br />
von einem Vater, der jetzt Rentner<br />
ist, sind alle Väter in Arbeit. Unter den Müttern<br />
sind vier Hausfrauen, eine Studentin<br />
und eine Rentnerin, der Rest arbeitet zeitweise<br />
oder ganztägig.<br />
Da die Eltern dieser Umfrage sich in einer<br />
vergleichsweise privilegierten Gruppe<br />
befi nden, kann auch hier kein Vergleich<br />
vorgenommen werden. Höchstens könnten<br />
tentativ zwei Elternpaare verglichen werden,<br />
wobei das eine Paar mit der mittleren<br />
Reife abgeschlossen hat, während die beiden<br />
anderen Eltern beide einen Hochschulabschluss<br />
besitzen. Es gibt jedoch keinen<br />
Unterschied in der jetzigen Sprachkompetenz<br />
der erwachsenen Kinder. Sie können<br />
sich beide sowohl auf Deutsch als auch Englisch<br />
gut ausdrücken. Dies würde die Th ese<br />
Mahlstedts und Saunders’ unterstützen,<br />
dass die Motivation der Eltern, ihre Kinder<br />
zweisprachig aufwachsen zu lassen, der entscheidende<br />
Faktor für eine gelungene Zweisprachigkeit<br />
ist.<br />
Bisher wurden die Sozialdaten in Verbindung<br />
mit der Sprachentwicklung gesehen,<br />
um einen eventuellen Zusammenhang zu<br />
ermitteln.<br />
Ein deutlicher Zusammenhang der<br />
Sprachentwicklung mit dem Geschlecht des<br />
Kindes, mit der Geschwisterstellung, dem<br />
Besuch einer öff entlichen Einrichtung oder<br />
der Ausbildung der Eltern konnte hier nicht<br />
nachgewiesen werden.<br />
Im Folgenden soll ein potenzieller Einfl uss<br />
der syndromspezifi schen Auff älligkeiten<br />
ermittelt werden. Dabei werden die Antworten<br />
aus Block B, medizinischer Hintergrund,<br />
herangezogen.<br />
Die Form der Trisomie kann auf die Sprachentwicklung<br />
einen Einfl uss ausüben. Hier<br />
haben jedoch alle außer einem Kind die<br />
Form Trisomie 21, somit ist kein Vergleich<br />
möglich.<br />
Neun der 19 Kinder hatten oder haben Erkrankungen,<br />
die längere Krankenhausaufenthalte<br />
erfordert haben. Kinder, die<br />
über längere Zeit krank sind und viel Zeit<br />
im Krankenhaus verbringen, bekommen<br />
einen anderen bzw. begrenzteren Input als<br />
gesunde Kinder. Die Sprachentwicklung<br />
kann davon beeinfl usst werden.<br />
Die Sprachentwicklung der Kinder dieser<br />
Untersuchung ist jedoch nicht von den<br />
Krankenhausaufenthalten beeinfl usst worden:<br />
Drei der Kinder können sich in beiden<br />
Sprachen gut ausdrücken und zwei können<br />
sich für die Familie in beiden Sprachen gut<br />
ausdrücken.<br />
Die weiteren vier können sich alle in einer<br />
Sprache gut ausdrücken, einmal wurde<br />
Auch für die Familie schwierig angekreuzt<br />
und einmal Schlecht. Für diese vier Kinder<br />
entspricht die Sprache, die sie am besten<br />
beherrschen, in jedem Fall der Umgebungssprache.<br />
Auch der Muskeltonus steht mit der<br />
Sprachentwicklung in Verbindung. Ein<br />
schwacher Muskeltonus führt zu begrenzten<br />
motorischen Fähigkeiten, die wiederum besonders<br />
die Artikulation und die Verständlichkeit<br />
der Sprache beeinfl ussen. Auch<br />
indirekt beeinfl usst die Motorik die emotional-sozialen<br />
Verhaltensweisen. Bei zwölf<br />
der 19 Kinder dieser Befragung wird der<br />
Muskeltonus als gut eingeschätzt, bei sechs<br />
als schwach und bei einem als sehr schwach.<br />
Die Kinder, deren Muskeltonus als gut eingeschätzt<br />
wird, haben durchschnittlich mit<br />
1,8 angefangen zu sprechen. Die Kinder<br />
mit einem schwachen oder sehr schwachen<br />
Muskeltonus fi ngen durchschnittlich genau<br />
zur selben Zeit an.<br />
Das einzige Kind, dessen Muskeltonus<br />
als sehr schwach eingeschätzt wird, hat dagegen<br />
schon mit 1,6 die ersten Wörter geäußert.<br />
Der Einfl uss des Muskeltonus auf die<br />
Sprachentwicklung ist in dieser Befragung<br />
nicht eindeutig feststellbar. Dieses Ergebnis<br />
ist überraschend, da der direkte und indirekte<br />
Einfl uss des Muskeltonus auf die<br />
Sprachentwicklung in der Fachliteratur her-<br />
vorgehoben wird. Eine mögliche Erklärung<br />
könnte sein, dass bei mehrsprachiger Erziehung<br />
Faktoren wie sprachliches Umfeld<br />
oder Qualität des Inputs eine größere Rolle<br />
spielen.