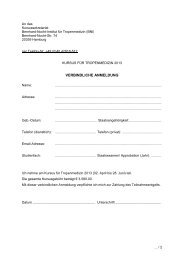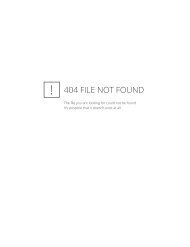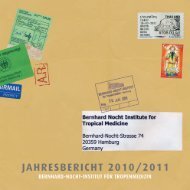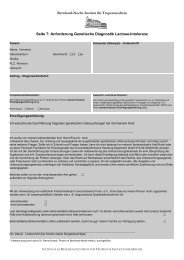Research Group Heussler (Malaria I) - Bernhard-Nocht-Institut für ...
Research Group Heussler (Malaria I) - Bernhard-Nocht-Institut für ...
Research Group Heussler (Malaria I) - Bernhard-Nocht-Institut für ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AIDS-Forschung hat eine lange zurückreichende Geschichte<br />
am BNI, da bereits 1982 die ersten Patienten mit<br />
den damals „exotischen“ Folgeinfektionen am BNI behandelt<br />
wurden. In den Abteilungen Pathologie und Virologie<br />
werden die Verteilung des HIV im lymphatischen<br />
Gewebe, die Verbreitung des Virus nach Infektion über<br />
die Schleimhäute und die Bildung neutralisierender Antikörper<br />
gegen das Glykoprotein gp120 untersucht. Die<br />
Quantifizierung der Viren und der virusproduzierenden<br />
Zellen im lymphatischen Gewebe zeigen, dass auch in<br />
asymptomatischen Patienten im Lymphknoten eine Virusreplikation<br />
stattfindet und dass selbst unter hochaktiver<br />
antiretroviraler Therapie das Virus jahrelang persistiert<br />
und sogar repliziert. Diese Ergebnisse haben direkte Bedeutung<br />
<strong>für</strong> die Festlegung der notwendigen Intensität<br />
und Dauer der Therapie. Ein von der Europäischen Union<br />
finanziertes Konsortium von Wissenschaftlern aus mehreren<br />
europäischen Ländern wird von Prof. Racz geführt,<br />
und arbeitet über neue Wege der Impfung gegen HIV.<br />
Kooperative Forschung in den Tropen<br />
Das BNI führt zahlreiche Forschungsprojekte in den Tropen<br />
durch, mehrere haben zu dauerhaften Partnerschaften<br />
geführt. Das Kumasi Centre for Collaborative <strong>Research</strong><br />
in Tropical Medicine (KCCR) ist die prominenteste<br />
Kooperation, ein gemeinsames Projekt des BNI und der<br />
Medizinischen Fakultät der Universität Kumasi, Ghana.<br />
Durch einen Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt<br />
Hamburg und der Republik Ghana wurde 1997<br />
die Errichtung des KCCR vereinbart. Die Grundidee bei<br />
der Durchführung von Forschungsprojekten ist die Kooperation.<br />
Alle wissenschaftlichen Projekte werden<br />
gleichberechtigt von einem Mitarbeiter des Tropeninstituts<br />
und einem ghanaischen Wissenschaftler geleitet.<br />
Das KCCR soll sich langfristig zu einem Zentrum der internationalen<br />
Zusammenarbeit entwickeln, denn auch<br />
Wissenschaftler anderer <strong>Institut</strong>ionen sind eingeladen,<br />
zusammen mit ghanaischen Partnern dort Forschungsprojekte<br />
durchführen. Das KCCR ist bemüht, den wissenschaftlichen<br />
Nachwuchs zu fördern, Ärzten und Wissenschaftlern<br />
die Weiterbildung und internationalen Austausch<br />
zu ermöglichen. Gleichzeitig werden im Rahmen<br />
der Forschungsprojekte Stellen <strong>für</strong> ghanaische Wissenschaftler<br />
geschaffen.<br />
Das KCCR hat sich in den letzten 2 Jahren stark vergrößert,<br />
es beschäftigt inzwischen über 80 feste Angestellte<br />
und bis zu 130 Zeitkräfte, von denen die meisten<br />
aus Projektmitteln finanziert werden. Das KCCR führt<br />
selbst keine Forschungsarbeiten durch, sondern bietet<br />
die Infrastruktur <strong>für</strong> die Durchführung von Projekten. Im<br />
Jahr 2003 wurden die Bauarbeiten <strong>für</strong> ein Ensemble von<br />
eigenen Gebäuden des KCCR beendet, die mit Mitteln<br />
der Volkswagen-Stiftung, der Träger in Bonn und Hamburg<br />
und der Vereinigung der Freunde des Tropeninstituts<br />
Hamburg errichtet worden waren. Am 13.11.2003 erfolgte<br />
die feierliche Einweihung.<br />
Andere langfristige Kooperationsprojekte mit offiziel-<br />
15<br />
Vorwort<br />
len Vereinbarungen werden mit der Medizinischen Fakultät<br />
der Universität von Hué, Vietnam, dem Central Drug<br />
<strong>Research</strong> <strong>Institut</strong>e in Lucknow, Indien, und mit dem<br />
Uganda Virus <strong>Research</strong> <strong>Institut</strong>e in Entebbe durchgeführt.<br />
Ereignisse 2002 und 2003<br />
Eine Chronik der Ereignisse der Zeit dieses Berichtes ist<br />
im Anhang zu finden. Herausragend und von großer Bedeutung<br />
<strong>für</strong> die Zukunft des BNI war die Evaluierung<br />
durch eine Begutachtungskommission des Senates der<br />
Leibniz-Gemeinschaft. Evaluierungen hatten davor in<br />
1985 und 1996 stattgefunden. Die Kommission hatte<br />
eine überaus umfangreiche Dokumentation der Arbeit<br />
des BNI erhalten und kam zur Begutachtung am 25. und<br />
26. Juni 2002 ins BNI. Die Evaluierung wurde am 1. April<br />
2003 mit der Verabschiedung der Stellungnahme des Senates<br />
abgeschlossen. Der Senat stellt fest, dass „die Forschung<br />
des BNI in wesentlichen Arbeitseinheiten als sehr<br />
gut, zum Teil hervorragend eingeschätzt wird, <strong>für</strong> die klinische<br />
Abteilung sollte dieser Stand ebenfalls angestrebt<br />
werden“[…..] „Die Nachwuchsförderung ist beispielgebend.<br />
Die Arbeitsergebnisse des BNI treffen national und<br />
international auf hohe fachliche Resonanz, […..]“ Als Konsequenz<br />
wird empfohlen, „das BNI angesichts seiner insgesamt<br />
hervorragenden Leistungen in der Forschung<br />
nachhaltig besser auszustatten.“ […..] „Es sollten alle<br />
Möglichkeiten genutzt werden, das BNI als Kompetenzzentrum<br />
<strong>für</strong> den Bereich Infektionsbiologie zu stärken<br />
und die Mittelausstattung <strong>für</strong> die Forschung zu verbessern.“<br />
Das BNI hofft nun, mit diesem so positivem Votum<br />
langfristig eine Verbesserung seiner zu knappen Ausstattung<br />
zu erreichen.<br />
Identifizierung des SARS Coronavirus<br />
Während der SARS-Epidemie im Frühjahr 2003 war die<br />
Abteilung <strong>für</strong> Virologie Mitglied eines von der WHO geführten<br />
internationalen Netzwerkes von Laboratorien. Als<br />
ein Virus von einem Patienten mit SARS am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Virologie<br />
der Universität Frankfurt angezüchtet wurde, erhielt<br />
das BNI eine Probe zur molekularen Analyse. In der<br />
Abteilung <strong>für</strong> Virologie des BNI war gerade eine eine<br />
neue Methode etabliert worden, mit der auch unbekannte<br />
Viren durch PCR mit degenerierten Primern identifiziert<br />
werden konnten. Diese Methode bestand ihre<br />
Probe bei der Analyse des unbekannten Virus. Die PCR<br />
<strong>für</strong> das vermutete Paramyxovirus blieb negativ, aber mit<br />
Primern gegen das Gelbfiebervirus Polymerase-Gen<br />
konnten Sequenzen des neuen Virus amplifiziert werden,<br />
die von einem unbekannten Coronavirus stammten.<br />
Diese Identifizierung des Virus erfolgte in einem Kopf-an-<br />
Kopf-Rennen mehrerer Labors, die mit unterschiedlichen<br />
Testverfahren nach dem neuen Virus suchten. Die Ergebnisse<br />
wurden gleichzeitig mit den CDC in Atlanta und der<br />
Universität Hongkong publiziert. Innerhalb von 2 Tagen<br />
konnten die Virologen eine sensitive PCR <strong>für</strong> das SARS