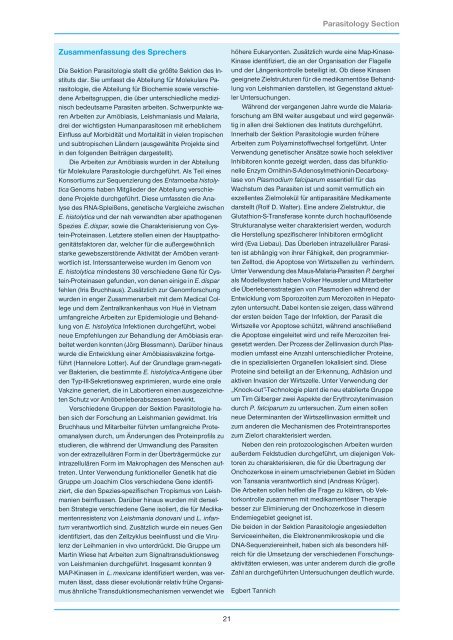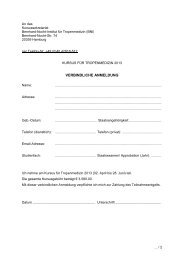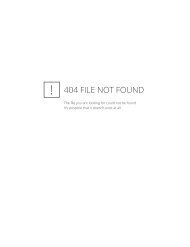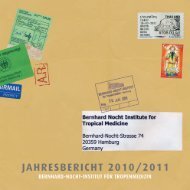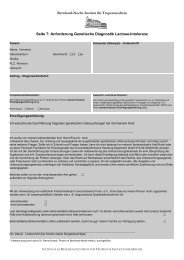Research Group Heussler (Malaria I) - Bernhard-Nocht-Institut für ...
Research Group Heussler (Malaria I) - Bernhard-Nocht-Institut für ...
Research Group Heussler (Malaria I) - Bernhard-Nocht-Institut für ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Zusammenfassung des Sprechers<br />
Die Sektion Parasitologie stellt die größte Sektion des <strong>Institut</strong>s<br />
dar. Sie umfasst die Abteilung <strong>für</strong> Molekulare Parasitologie,<br />
die Abteilung <strong>für</strong> Biochemie sowie verschiedene<br />
Arbeitsgruppen, die über unterschiedliche medizinisch<br />
bedeutsame Parasiten arbeiten. Schwerpunkte waren<br />
Arbeiten zur Amöbiasis, Leishmaniasis und <strong>Malaria</strong>,<br />
drei der wichtigsten Humanparasitosen mit erheblichem<br />
Einfluss auf Morbidität und Mortalität in vielen tropischen<br />
und subtropischen Ländern (ausgewählte Projekte sind<br />
in den folgenden Beiträgen dargestellt).<br />
Die Arbeiten zur Amöbiasis wurden in der Abteilung<br />
<strong>für</strong> Molekulare Parasitologie durchgeführt. Als Teil eines<br />
Konsortiums zur Sequenzierung des Entamoeba histolytica<br />
Genoms haben Mitglieder der Abteilung verschiedene<br />
Projekte durchgeführt. Diese umfassten die Analyse<br />
des RNA-Spleißens, genetische Vergleiche zwischen<br />
E. histolytica und der nah verwandten aber apathogenen<br />
Spezies E.dispar, sowie die Charakterisierung von Cystein-Proteinasen.<br />
Letztere stellen einen der Hauptpathogenitätsfaktoren<br />
dar, welcher <strong>für</strong> die außergewöhnlich<br />
starke gewebszerstörende Aktivität der Amöben verantwortlich<br />
ist. Interssanterweise wurden im Genom von<br />
E. histolytica mindestens 30 verschiedene Gene <strong>für</strong> Cystein-Proteinasen<br />
gefunden, von denen einige in E. dispar<br />
fehlen (Iris Bruchhaus). Zusätzlich zur Genomforschung<br />
wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Medical College<br />
und dem Zentralkrankenhaus von Hué in Vietnam<br />
umfangreiche Arbeiten zur Epidemiologie und Behandlung<br />
von E. histolytica Infektionen durchgeführt, wobei<br />
neue Empfehlungen zur Behandlung der Amöbiasis erarbeitet<br />
werden konnten (Jörg Blessmann). Darüber hinaus<br />
wurde die Entwicklung einer Amöbiasisvakzine fortgeführt<br />
(Hannelore Lotter). Auf der Grundlage gram-negativer<br />
Bakterien, die bestimmte E. histolytica-Antigene über<br />
den Typ-III-Sekretionsweg exprimieren, wurde eine orale<br />
Vakzine generiert, die in Labortieren einen ausgezeichneten<br />
Schutz vor Amöbenleberabszessen bewirkt.<br />
Verschiedene Gruppen der Sektion Parasitologie haben<br />
sich der Forschung an Leishmanien gewidmet. Iris<br />
Bruchhaus und Mitarbeiter führten umfangreiche Proteomanalysen<br />
durch, um Änderungen des Proteinprofils zu<br />
studieren, die während der Umwandlung des Parasiten<br />
von der extrazellulären Form in der Überträgermücke zur<br />
intrazellulären Form im Makrophagen des Menschen auftreten.<br />
Unter Verwendung funktioneller Genetik hat die<br />
Gruppe um Joachim Clos verschiedene Gene identifiziert,<br />
die den Spezies-spezifischen Tropismus von Leishmanien<br />
beinflussen. Darüber hinaus wurden mit derselben<br />
Strategie verschiedene Gene isoliert, die <strong>für</strong> Medikamentenresistenz<br />
von Leishmania donovani und L. infantum<br />
verantwortlich sind. Zusätzlich wurde ein neues Gen<br />
identifiziert, das den Zellzyklus beeinflusst und die Virulenz<br />
der Leihmanien in vivo unterdrückt. Die Gruppe um<br />
Martin Wiese hat Arbeiten zum Signaltransduktionsweg<br />
von Leishmanien durchgeführt. Insgesamt konnten 9<br />
MAP-Kinasen in L. mexicana identifiziert werden, was vermuten<br />
lässt, dass dieser evolutionär relativ frühe Organsimus<br />
ähnliche Transduktionsmechanismen verwendet wie<br />
21<br />
höhere Eukaryonten. Zusätzlich wurde eine Map-Kinase-<br />
Kinase identifiziert, die an der Organisation der Flagelle<br />
und der Längenkontrolle beteiligt ist. Ob diese Kinasen<br />
geeignete Zielstrukturen <strong>für</strong> die medikamentöse Behandlung<br />
von Leishmanien darstellen, ist Gegenstand aktueller<br />
Untersuchungen.<br />
Während der vergangenen Jahre wurde die <strong>Malaria</strong>forschung<br />
am BNI weiter ausgebaut und wird gegenwärtig<br />
in allen drei Sektionen des <strong>Institut</strong>s durchgeführt.<br />
Innerhalb der Sektion Parasitologie wurden frühere<br />
Arbeiten zum Polyaminstoffwechsel fortgeführt. Unter<br />
Verwendung genetischer Ansätze sowie hoch selektiver<br />
Inhibitoren konnte gezeigt werden, dass das bifunktionelle<br />
Enzym Ornithin-S-Adenosylmethionin-Decarboxylase<br />
von Plasmodium falciparum essentiell <strong>für</strong> das<br />
Wachstum des Parasiten ist und somit vermutlich ein<br />
exzellentes Zielmolekül <strong>für</strong> antiparasitäre Medikamente<br />
darstellt (Rolf D. Walter). Eine andere Zielstruktur, die<br />
Glutathion-S-Transferase konnte durch hochauflösende<br />
Strukturanalyse weiter charakterisiert werden, wodurch<br />
die Herstellung spezifischerer Inhibitoren ermöglicht<br />
wird (Eva Liebau). Das Überleben intrazellulärer Parasiten<br />
ist abhängig von ihrer Fähigkeit, den programmierten<br />
Zelltod, die Apoptose von Wirtszellen zu verhindern.<br />
Unter Verwendung des Maus-<strong>Malaria</strong>-Parasiten P. berghei<br />
als Modellsystem haben Volker <strong>Heussler</strong> und Mitarbeiter<br />
die Überlebensstrategien von Plasmodien während der<br />
Entwicklung vom Sporozoiten zum Merozoiten in Hepatozyten<br />
untersucht. Dabei konten sie zeigen, dass während<br />
der ersten beiden Tage der Infektion, der Parasit die<br />
Wirtszelle vor Apoptose schützt, während anschließend<br />
die Apoptose eingeleitet wird und reife Merozoiten freigesetzt<br />
werden. Der Prozess der Zellinvasion durch Plasmodien<br />
umfasst eine Anzahl unterschiedlicher Proteine,<br />
die in spezialisierten Organellen lokalisiert sind. Diese<br />
Proteine sind beteiligt an der Erkennung, Adhäsion und<br />
aktiven Invasion der Wirtszelle. Unter Verwendung der<br />
„Knock-out”-Technologie plant die neu etablierte Gruppe<br />
um Tim Gilberger zwei Aspekte der Erythrozyteninvasion<br />
durch P. falciparum zu untersuchen. Zum einen sollen<br />
neue Determinanten der Wirtszellinvasion ermittelt und<br />
zum anderen die Mechanismen des Proteintransportes<br />
zum Zielort charakterisiert werden.<br />
Neben den rein protozoologischen Arbeiten wurden<br />
außerdem Feldstudien durchgeführt, um diejenigen Vektoren<br />
zu charakterisieren, die <strong>für</strong> die Übertragung der<br />
Onchozerkose in einem umschriebenen Gebiet im Süden<br />
von Tansania verantwortlich sind (Andreas Krüger).<br />
Die Arbeiten sollen helfen die Frage zu klären, ob Vektorkontrolle<br />
zusammen mit medikamentöser Therapie<br />
besser zur Eliminierung der Onchozerkose in diesem<br />
Endemiegebiet geeignet ist.<br />
Die beiden in der Sektion Parasitologie angesiedelten<br />
Serviceeinheiten, die Elektronenmikroskopie und die<br />
DNA-Sequenziereinheit, haben sich als besonders hilfreich<br />
<strong>für</strong> die Umsetzung der verschiedenen Forschungsaktivitäten<br />
erwiesen, was unter anderem durch die große<br />
Zahl an durchgeführten Untersuchungen deutlich wurde.<br />
Egbert Tannich<br />
Parasitology Section