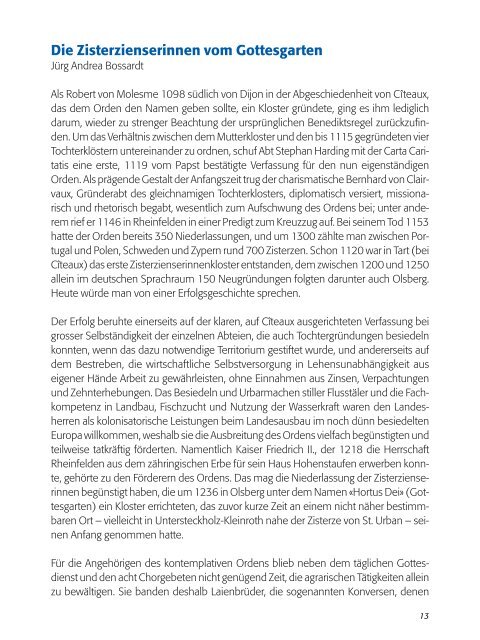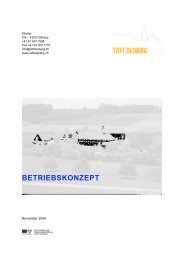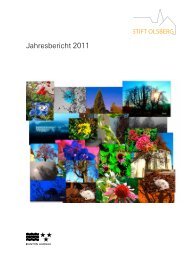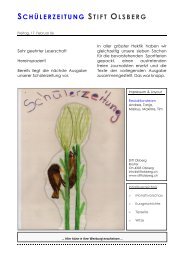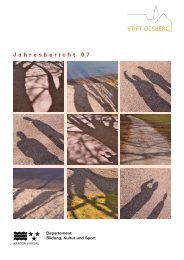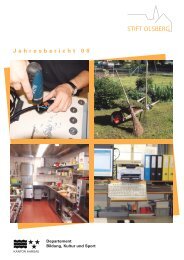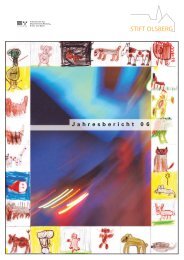150 Jahre Stift Olsberg
150 Jahre Stift Olsberg
150 Jahre Stift Olsberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Zisterzienserinnen vom Gottesgarten<br />
Jürg Andrea Bossardt<br />
Als Robert von Molesme 1098 südlich von Dijon in der Abgeschiedenheit von Cîteaux,<br />
das dem Orden den Namen geben sollte, ein Kloster gründete, ging es ihm lediglich<br />
darum, wieder zu strenger Beachtung der ursprünglichen Benediktsregel zurückzufinden.<br />
Um das Verhältnis zwischen dem Mutterkloster und den bis 1115 gegründeten vier<br />
Tochterklöstern untereinander zu ordnen, schuf Abt Stephan Harding mit der Carta Caritatis<br />
eine erste, 1119 vom Papst bestätigte Verfassung für den nun eigenständigen<br />
Orden. Als prägende Gestalt der Anfangszeit trug der charismatische Bernhard von Clairvaux,<br />
Gründerabt des gleichnamigen Tochterklosters, diplomatisch versiert, missionarisch<br />
und rhetorisch begabt, wesentlich zum Aufschwung des Ordens bei; unter anderem<br />
rief er 1146 in Rheinfelden in einer Predigt zum Kreuzzug auf. Bei seinem Tod 1153<br />
hatte der Orden bereits 350 Niederlassungen, und um 1300 zählte man zwischen Portugal<br />
und Polen, Schweden und Zypern rund 700 Zisterzen. Schon 1120 war in Tart (bei<br />
Cîteaux) das erste Zisterzienserinnenkloster entstanden, dem zwischen 1200 und 1250<br />
allein im deutschen Sprachraum <strong>150</strong> Neugründungen folgten darunter auch <strong>Olsberg</strong>.<br />
Heute würde man von einer Erfolgsgeschichte sprechen.<br />
Der Erfolg beruhte einerseits auf der klaren, auf Cîteaux ausgerichteten Verfassung bei<br />
grosser Selbständigkeit der einzelnen Abteien, die auch Tochtergründungen besiedeln<br />
konnten, wenn das dazu notwendige Territorium gestiftet wurde, und andererseits auf<br />
dem Bestreben, die wirtschaftliche Selbstversorgung in Lehensunabhängigkeit aus<br />
eigener Hände Arbeit zu gewährleisten, ohne Einnahmen aus Zinsen, Verpachtungen<br />
und Zehnterhebungen. Das Besiedeln und Urbarmachen stiller Flusstäler und die Fachkompetenz<br />
in Landbau, Fischzucht und Nutzung der Wasserkraft waren den Landesherren<br />
als kolonisatorische Leistungen beim Landesausbau im noch dünn besiedelten<br />
Europa willkommen, weshalb sie die Ausbreitung des Ordens vielfach begünstigten und<br />
teilweise tatkräftig förderten. Namentlich Kaiser Friedrich II., der 1218 die Herrschaft<br />
Rheinfelden aus dem zähringischen Erbe für sein Haus Hohenstaufen erwerben konnte,<br />
gehörte zu den Förderern des Ordens. Das mag die Niederlassung der Zisterzienserinnen<br />
begünstigt haben, die um 1236 in <strong>Olsberg</strong> unter dem Namen «Hortus Dei» (Gottesgarten)<br />
ein Kloster errichteten, das zuvor kurze Zeit an einem nicht näher bestimmbaren<br />
Ort – vielleicht in Untersteckholz-Kleinroth nahe der Zisterze von St. Urban – seinen<br />
Anfang genommen hatte.<br />
Für die Angehörigen des kontemplativen Ordens blieb neben dem täglichen Gottesdienst<br />
und den acht Chorgebeten nicht genügend Zeit, die agrarischen Tätigkeiten allein<br />
zu bewältigen. Sie banden deshalb Laienbrüder, die sogenannten Konversen, denen<br />
13